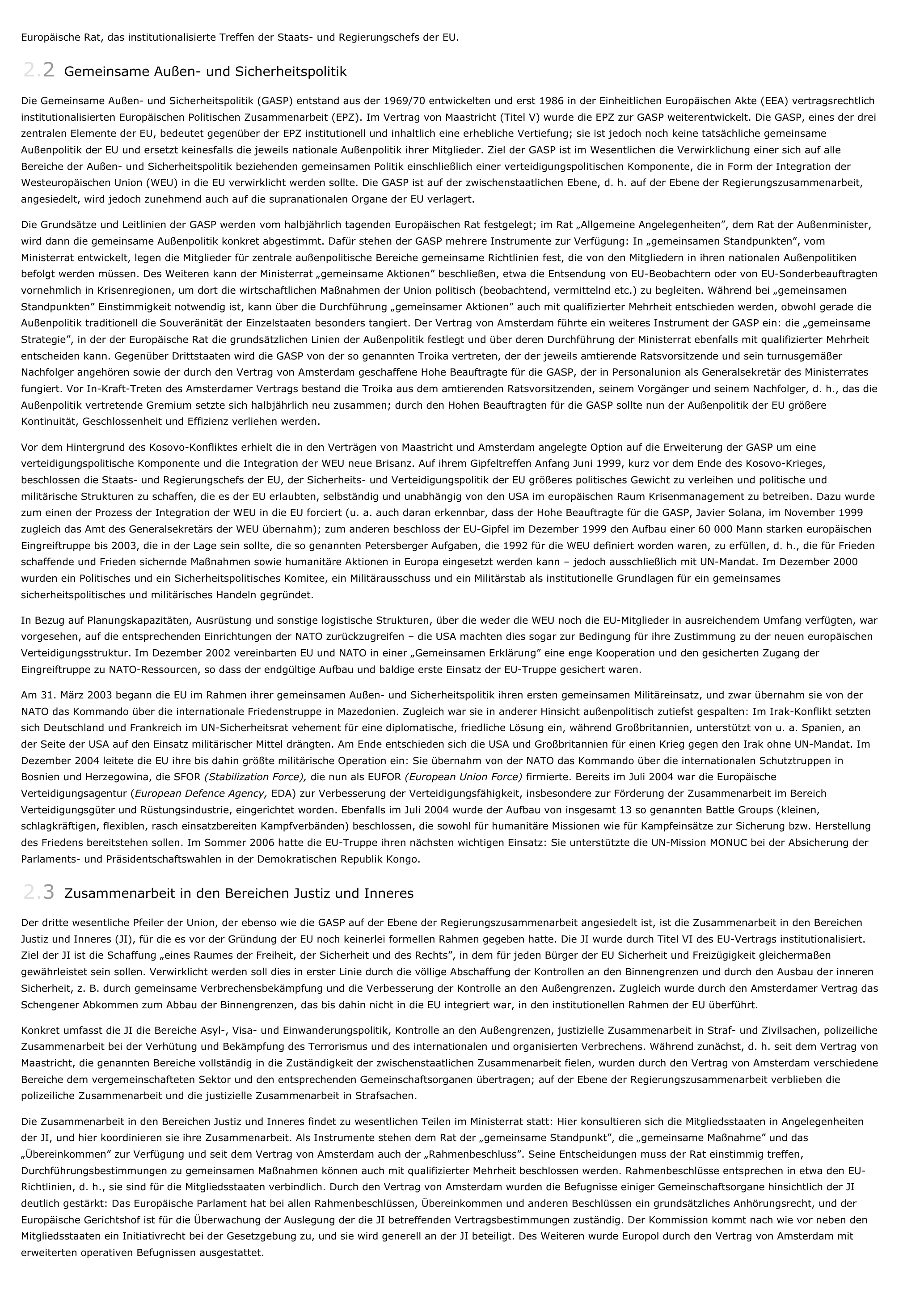Europäische Union - Geschichte. 1 EINLEITUNG Europäische Union (EU), Verbund europäischer Staaten, gegründet durch den Vertrag von Maastricht (offiziell: Vertrag über die Europäische Union, kurz: EU-Vertrag), den die zwölf Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaften (EG) am 7. Februar 1992 unterzeichneten und der am 1. November 1993 in Kraft trat, modifiziert und erweitert durch den am 1. Mai 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam. Die EU gründet auf den Europäischen Gemeinschaften, die in ihren Aufgaben und Kompetenzen durch den Vertrag von Maastricht tief greifend modifiziert und um die gemeinsamen Politikfelder Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (JI) von einer primär wirtschaftlichen zur politischen, zur Europäischen Union erweitert wurden. Ziel der EU ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes mit freiem Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr und die Vertiefung der politischen Integration ihrer Mitglieder. Der EU gehören 27 Staaten mit einer Gesamtfläche von rund 4,35 Millionen Quadratkilometern und einer Gesamtbevölkerung von etwa 486 Millionen Menschen an: die zwölf Gründerstaaten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien sowie seit dem 1. Januar 1995 Finnland, Österreich und Schweden, seit dem 1. Mai 2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern und seit dem 1. Januar 2007 Bulgarien und Rumänien. Die Mitgliedsstaaten der EU sind weiterhin selbständige und souveräne Staaten, haben sich aber für bestimmte Politikbereiche zu einer gemeinschaftlichen Politik bzw. zur Abstimmung ihrer Politiken verpflichtet und unterliegen in manchen Bereichen der Rechtssetzungskompetenz der EU. Die EU ist eine supranationale Organisation, jedoch keine auf internationaler Ebene anerkannte juristische Person, so dass z. B. Verträge mit Drittländern weiterhin im Namen der EG abgeschlossen werden. Sie ist gekennzeichnet durch das Nebeneinander von supranationaler Rechtssetzung und Zusammenarbeit auf Regierungsebene bei gleichzeitig noch wenig ausgeprägter demokratischer Legitimation. Die Politikbereiche sind je nach ihrer Relevanz für die gemeinsamen Aufgaben und Ziele unterschiedlich stark vergemeinschaftet, d. h. der Rechtssetzung der Gemeinschaftsorgane unterworfen, und verlangen je nach dem Grad der Vergemeinschaftung die Übertragung nationaler Souveränitätsrechte auf die Gemeinschaft. 2 DIE DREI PFEILER DER EU Die EU als das gemeinsame politische Dach der europäischen Integration basiert auf drei so genannten Pfeilern: auf der EG als dem ersten und wichtigsten Pfeiler und wirtschaftlichem Fundament, auf der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) als dem zweiten und der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (JI) als dem dritten Pfeiler. Der erste Pfeiler repräsentiert die vergemeinschaftete Dimension, der zweite und der dritte Pfeiler sind auf der Ebene der Regierungszusammenarbeit angesiedelt. 2.1 Europäische Gemeinschaft Die Europäische Gemeinschaft (nicht zu verwechseln mit den Europäischen Gemeinschaften) wurde durch den Titel II des EU-Vertrags (,,Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft") aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschaffen und gegenüber der EWG mit weiter reichenden Kompetenzen und Aufgaben ausgestattet. Aufgabe der EG ist laut dem reformierten EWG-Vertrag (EG-Vertrag) die Errichtung des Binnenmarktes und die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion - die Kernstücke der EU überhaupt - sowie darauf aufbauend die Sorge um eine ,,harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ... den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten". Die Kompetenzen der EG konzentrieren sich entsprechend auf den wirtschafts- und finanzpolitischen Bereich: die Ausgestaltung des am 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Binnenmarkts, die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion, die mit der Einführung des Euro in elf der damals 15 EU-Staaten am 1. Januar 1999 die dritte und letzte Stufe erreichte (siehe Europäische Währungsunion), die gemeinsame Agrarpolitik, die etwa die Hälfte des gesamten EU-Haushaltes beansprucht, die gemeinsame Strukturpolitik inklusive der Verwaltung der Strukturfonds etc. Je nach Bereich verfügt die EG über mehr oder weniger weit reichende, von den Mitgliedsstaaten übertragene Rechtssetzungskompetenzen. Besonders in den in hohem Maße vergemeinschafteten Bereichen, in denen sich die Mitglieder zu einer ,,gemeinsamen Politik" verpflichtet haben - wie etwa der Wirtschafts- und Währungsunion und der gemeinsamen Agrarpolitik - können die Organe der Gemeinschaft Recht setzen, das unmittelbar für alle Mitgliedsstaaten und alle natürlichen und juristischen Personen der EU gilt, ebenso wie für die Gemeinschaft und ihre Organe selbst. Neben diesen so genannten Verordnungen kann die Gemeinschaft auch Richtlinien erlassen, ebenfalls rechtsverbindliche Anordnungen, die von den Mitgliedern in jeweils nationales Recht umgesetzt werden müssen. Durch die Verträge von Maastricht und Amsterdam wurden die Kompetenzen der EG in einigen Bereichen deutlich erweitert, z. B. in der Beschäftigungs- und Sozialpolitik (so wurde durch die Aufnahme des Sozialabkommens in den Amsterdamer Vertrag eine gemeinsame Sozialpolitik institutionalisiert), in der Umweltpolitik sowie im Hinblick auf die Transeuropäischen Netze und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung. Durch den Amsterdamer Vertrag wurden zudem einige wichtige Aspekte aus dem dritten Pfeiler in die Kompetenz des vergemeinschafteten Bereichs übertragen, und zwar die Asyl-, die Flüchtlings- und die Visapolitik, die Außengrenzenkontrollen, die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen und die Bekämpfung von Betrügereien zu Lasten des EU-Haushaltes (Titel IV des revidierten EG-Vertrags). Bei all ihren Tätigkeiten und Initiativen folgt die Gemeinschaft dem im EG-Vertrag festgeschriebenen Prinzip der Subsidiarität, d. h., sie wird in Bereichen, für die nicht ausschließlich sie zuständig ist, nur dann tätig, wenn ein Vorgehen der Gemeinschaft wirksamer ist als Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene. Daneben unterliegt die Tätigkeit der Gemeinschaft den Prinzipien der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit, d. h., ihre Maßnahmen dürfen nicht über das zur Verwirklichung der Vertragsziele Notwendige hinausgehen. Durch diese Maximen soll eine möglichst große Bürgernähe bei den Entscheidungen gewährleistet und Zentralismus und Bürokratie in einem angemessenen Rahmen gehalten werden. 2.1.1 Organe Die supranationalen Organe der EG bzw. der EU insgesamt sind im Wesentlichen identisch mit denen ihrer Vorgängerorganisation EWG bzw. Europäische Gemeinschaften; durch die Verträge von Maastricht und Amsterdam wurden jedoch ihre Aufgaben und Kompetenzen teilweise modifiziert, und es kamen einige neue Gemeinschaftsorgane hinzu. Oberstes Entscheidungs- und Gesetzgebungsorgan ist der Rat der Europäischen Union (Ministerrat), wichtigstes Exekutivorgan ist die Europäische Kommission. Das Europäische Parlament, die direkt gewählte Volksvertretung der EU, hatte vor Gründung der EU außer haushaltspolitischen kaum Kompetenzen; seither wurden seine Befugnisse als legislatives und Kontrollorgan deutlich ausgeweitet. Die Judikative der EU liegt beim Europäischen Gerichtshof, die Kontrolle der Haushaltsführung beim Europäischen Rechnungshof. Zur Überwachung des Europäischen Währungssystems wurde 1994 das Europäische Währungsinstitut gegründet, das am 1. Juli 1998 von der Europäischen Zentralbank abgelöst wurde. Nur beratende Funktion haben der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der durch den Vertrag von Maastricht gegründete Ausschuss der Regionen; sie müssen allerdings in allen sie betreffenden Fragen vom Ministerrat und der Kommission gehört werden. Ebenfalls durch den Vertrag von Maastricht neu geschaffen wurde das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten, bei dem jeder Bürger der EU Klage gegen Missstände, Willkür oder Versäumnisse der Organe und Institutionen der Gemeinschaft einreichen kann. Oberste, die politischen Leitlinien vorgebende Instanz der EU, jedoch kein Organ im eigentlichen Sinne, ist der Europäische Rat, das institutionalisierte Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. 2.2 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) entstand aus der 1969/70 entwickelten und erst 1986 in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vertragsrechtlich institutionalisierten Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ). Im Vertrag von Maastricht (Titel V) wurde die EPZ zur GASP weiterentwickelt. Die GASP, eines der drei zentralen Elemente der EU, bedeutet gegenüber der EPZ institutionell und inhaltlich eine erhebliche Vertiefung; sie ist jedoch noch keine tatsächliche gemeinsame Außenpolitik der EU und ersetzt keinesfalls die jeweils nationale Außenpolitik ihrer Mitglieder. Ziel der GASP ist im Wesentlichen die Verwirklichung einer sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik beziehenden gemeinsamen Politik einschließlich einer verteidigungspolitischen Komponente, die in Form der Integration der Westeuropäischen Union (WEU) in die EU verwirklicht werden sollte. Die GASP ist auf der zwischenstaatlichen Ebene, d. h. auf der Ebene der Regierungszusammenarbeit, angesiedelt, wird jedoch zunehmend auch auf die supranationalen Organe der EU verlagert. Die Grundsätze und Leitlinien der GASP werden vom halbjährlich tagenden Europäischen Rat festgelegt; im Rat ,,Allgemeine Angelegenheiten", dem Rat der Außenminister, wird dann die gemeinsame Außenpolitik konkret abgestimmt. Dafür stehen der GASP mehrere Instrumente zur Verfügung: In ,,gemeinsamen Standpunkten", vom Ministerrat entwickelt, legen die Mitglieder für zentrale außenpolitische Bereiche gemeinsame Richtlinien fest, die von den Mitgliedern in ihren nationalen Außenpolitiken befolgt werden müssen. Des Weiteren kann der Ministerrat ,,gemeinsame Aktionen" beschließen, etwa die Entsendung von EU-Beobachtern oder von EU-Sonderbeauftragten vornehmlich in Krisenregionen, um dort die wirtschaftlichen Maßnahmen der Union politisch (beobachtend, vermittelnd etc.) zu begleiten. Während bei ,,gemeinsamen Standpunkten" Einstimmigkeit notwendig ist, kann über die Durchführung ,,gemeinsamer Aktionen" auch mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden, obwohl gerade die Außenpolitik traditionell die Souveränität der Einzelstaaten besonders tangiert. Der Vertrag von Amsterdam führte ein weiteres Instrument der GASP ein: die ,,gemeinsame Strategie", in der der Europäische Rat die grundsätzlichen Linien der Außenpolitik festlegt und über deren Durchführung der Ministerrat ebenfalls mit qualifizierter Mehrheit entscheiden kann. Gegenüber Drittstaaten wird die GASP von der so genannten Troika vertreten, der der jeweils amtierende Ratsvorsitzende und sein turnusgemäßer Nachfolger angehören sowie der durch den Vertrag von Amsterdam geschaffene Hohe Beauftragte für die GASP, der in Personalunion als Generalsekretär des Ministerrates fungiert. Vor In-Kraft-Treten des Amsterdamer Vertrags bestand die Troika aus dem amtierenden Ratsvorsitzenden, seinem Vorgänger und seinem Nachfolger, d. h., das die Außenpolitik vertretende Gremium setzte sich halbjährlich neu zusammen; durch den Hohen Beauftragten für die GASP sollte nun der Außenpolitik der EU größere Kontinuität, Geschlossenheit und Effizienz verliehen werden. Vor dem Hintergrund des Kosovo-Konfliktes erhielt die in den Verträgen von Maastricht und Amsterdam angelegte Option auf die Erweiterung der GASP um eine verteidigungspolitische Komponente und die Integration der WEU neue Brisanz. Auf ihrem Gipfeltreffen Anfang Juni 1999, kurz vor dem Ende des Kosovo-Krieges, beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU größeres politisches Gewicht zu verleihen und politische und militärische Strukturen zu schaffen, die es der EU erlaubten, selbständig und unabhängig von den USA im europäischen Raum Krisenmanagement zu betreiben. Dazu wurde zum einen der Prozess der Integration der WEU in die EU forciert (u. a. auch daran erkennbar, dass der Hohe Beauftragte für die GASP, Javier Solana, im November 1999 zugleich das Amt des Generalsekretärs der WEU übernahm); zum anderen beschloss der EU-Gipfel im Dezember 1999 den Aufbau einer 60 000 Mann starken europäischen Eingreiftruppe bis 2003, die in der Lage sein sollte, die so genannten Petersberger Aufgaben, die 1992 für die WEU definiert worden waren, zu erfüllen, d. h., die für Frieden schaffende und Frieden sichernde Maßnahmen sowie humanitäre Aktionen in Europa eingesetzt werden kann - jedoch ausschließlich mit UN-Mandat. Im Dezember 2000 wurden ein Politisches und ein Sicherheitspolitisches Komitee, ein Militärausschuss und ein Militärstab als institutionelle Grundlagen für ein gemeinsames sicherheitspolitisches und militärisches Handeln gegründet. In Bezug auf Planungskapazitäten, Ausrüstung und sonstige logistische Strukturen, über die weder die WEU noch die EU-Mitglieder in ausreichendem Umfang verfügten, war vorgesehen, auf die entsprechenden Einrichtungen der NATO zurückzugreifen - die USA machten dies sogar zur Bedingung für ihre Zustimmung zu der neuen europäischen Verteidigungsstruktur. Im Dezember 2002 vereinbarten EU und NATO in einer ,,Gemeinsamen Erklärung" eine enge Kooperation und den gesicherten Zugang der Eingreiftruppe zu NATO-Ressourcen, so dass der endgültige Aufbau und baldige erste Einsatz der EU-Truppe gesichert waren. Am 31. März 2003 begann die EU im Rahmen ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ihren ersten gemeinsamen Militäreinsatz, und zwar übernahm sie von der NATO das Kommando über die internationale Friedenstruppe in Mazedonien. Zugleich war sie in anderer Hinsicht außenpolitisch zutiefst gespalten: Im Irak-Konflikt setzten sich Deutschland und Frankreich im UN-Sicherheitsrat vehement für eine diplomatische, friedliche Lösung ein, während Großbritannien, unterstützt von u. a. Spanien, an der Seite der USA auf den Einsatz militärischer Mittel drängten. Am Ende entschieden sich die USA und Großbritannien für einen Krieg gegen den Irak ohne UN-Mandat. Im Dezember 2004 leitete die EU ihre bis dahin größte militärische Operation ein: Sie übernahm von der NATO das Kommando über die internationalen Schutztruppen in Bosnien und Herzegowina, die SFOR (Stabilization Force), die nun als EUFOR (European Union Force) firmierte. Bereits im Juli 2004 war die Europäische Verteidigungsagentur (European Defence Agency, EDA) zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit, insbesondere zur Förderung der Zusammenarbeit im Bereich Verteidigungsgüter und Rüstungsindustrie, eingerichtet worden. Ebenfalls im Juli 2004 wurde der Aufbau von insgesamt 13 so genannten Battle Groups (kleinen, schlagkräftigen, flexiblen, rasch einsatzbereiten Kampfverbänden) beschlossen, die sowohl für humanitäre Missionen wie für Kampfeinsätze zur Sicherung bzw. Herstellung des Friedens bereitstehen sollen. Im Sommer 2006 hatte die EU-Truppe ihren nächsten wichtigen Einsatz: Sie unterstützte die UN-Mission MONUC bei der Absicherung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Demokratischen Republik Kongo. 2.3 Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres Der dritte wesentliche Pfeiler der Union, der ebenso wie die GASP auf der Ebene der Regierungszusammenarbeit angesiedelt ist, ist die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (JI), für die es vor der Gründung der EU noch keinerlei formellen Rahmen gegeben hatte. Die JI wurde durch Titel VI des EU-Vertrags institutionalisiert. Ziel der JI ist die Schaffung ,,eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts", in dem für jeden Bürger der EU Sicherheit und Freizügigkeit gleichermaßen gewährleistet sein sollen. Verwirklicht werden soll dies in erster Linie durch die völlige Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und durch den Ausbau der inneren Sicherheit, z. B. durch gemeinsame Verbrechensbekämpfung und die Verbesserung der Kontrolle an den Außengrenzen. Zugleich wurde durch den Amsterdamer Vertrag das Schengener Abkommen zum Abbau der Binnengrenzen, das bis dahin nicht in die EU integriert war, in den institutionellen Rahmen der EU überführt. Konkret umfasst die JI die Bereiche Asyl-, Visa- und Einwanderungspolitik, Kontrolle an den Außengrenzen, justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen, polizeiliche Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und des internationalen und organisierten Verbrechens. Während zunächst, d. h. seit dem Vertrag von Maastricht, die genannten Bereiche vollständig in die Zuständigkeit der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit fielen, wurden durch den Vertrag von Amsterdam verschiedene Bereiche dem vergemeinschafteten Sektor und den entsprechenden Gemeinschaftsorganen übertragen; auf der Ebene der Regierungszusammenarbeit verblieben die polizeiliche Zusammenarbeit und die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres findet zu wesentlichen Teilen im Ministerrat statt: Hier konsultieren sich die Mitgliedsstaaten in Angelegenheiten der JI, und hier koordinieren sie ihre Zusammenarbeit. Als Instrumente stehen dem Rat der ,,gemeinsame Standpunkt", die ,,gemeinsame Maßnahme" und das ,,Übereinkommen" zur Verfügung und seit dem Vertrag von Amsterdam auch der ,,Rahmenbeschluss". Seine Entscheidungen muss der Rat einstimmig treffen, Durchführungsbestimmungen zu gemeinsamen Maßnahmen können auch mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Rahmenbeschlüsse entsprechen in etwa den EURichtlinien, d. h., sie sind für die Mitgliedsstaaten verbindlich. Durch den Vertrag von Amsterdam wurden die Befugnisse einiger Gemeinschaftsorgane hinsichtlich der JI deutlich gestärkt: Das Europäische Parlament hat bei allen Rahmenbeschlüssen, Übereinkommen und anderen Beschlüssen ein grundsätzliches Anhörungsrecht, und der Europäische Gerichtshof ist für die Überwachung der Auslegung der die JI betreffenden Vertragsbestimmungen zuständig. Der Kommission kommt nach wie vor neben den Mitgliedsstaaten ein Initiativrecht bei der Gesetzgebung zu, und sie wird generell an der JI beteiligt. Des Weiteren wurde Europol durch den Vertrag von Amsterdam mit erweiterten operativen Befugnissen ausgestattet. 3 AUSSENBEZIEHUNGEN Als weltweit größter Handelszusammenschluss hat die EU eine Fülle internationaler Beziehungen aufgebaut, fixiert in zahlreichen bi- und multilateralen Abkommen, die im Kern größtenteils als Handels- und Wirtschaftsbeziehungen angelegt sind, teilweise aber weit darüber hinaus in politische, kulturelle, humanitäre und soziale Dimensionen reichen. Vertreten wird die EU auf internationaler Ebene in der Regel von der Europäischen Kommission und dem Rat der EU, wobei die Kommission im Auftrag des Rates handelt. Wichtige internationale Verträge, insbesondere die Assoziierungsabkommen, bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die EU unterhält in zahlreichen Drittstaaten sowie bei mehreren internationalen Organisationen diplomatische Vertretungen; ebenso unterhalten mehr als 150 Drittstaaten Delegationen bei der EU. 3.1 Europäischer Wirtschaftsraum Besonders enge Verbindungen unterhält die EU zu den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA): Mit Island, Liechtenstein und Norwegen vereinbarte sie 1992 die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR, 1994 in Kraft getreten), d. h. die Ausdehnung des Europäischen Binnenmarktes auf die drei EFTA-Staaten, allerdings mit einigen Einschränkungen; z. B. blieb der Agrarsektor ausgeklammert, und die drei EFTA-Staaten haben keine Entscheidungsbefugnisse. Die Schweiz als vierter der EFTA-Staaten entschied sich in einer Volksabstimmung gegen eine Teilnahme am EWR, schloss aber 1999 sieben sektorielle, primär wirtschaftliche bilaterale Verträge mit der EU, die so genannten Bilateralen I (2000 durch eine Volksabstimmung angenommen), durch die die Schweiz in einige Bereiche des Europäischen Binnenmarktes integriert wird. 2004 folgte die Unterzeichnung von neuen weiteren bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU, den Bilateralen II (2005 durch Referendum bestätigt). 3.2 Europa-Abkommen Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks schloss die EU zu Beginn der neunziger Jahre mit zehn Staaten Mittel- und Osteuropas (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn) besondere Assoziierungsabkommen, die so genannten ,,Europa-Abkommen", die für die genannten zehn Staaten mit der Option auf eine Vollmitgliedschaft in der EU verbunden waren. Ziel der Europa-Abkommen war der Ausbau der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der EU und den assoziierten Staaten, der Abbau von Wirtschafts- und Handelsbeschränkungen, die Unterstützung des Transformationsprozesses in Richtung auf marktwirtschaftliche und demokratische Strukturen in diesen Staaten sowie ihre Heranführung an die EU. Seit 1990 ließ die EU den Staaten des Europa-Abkommens umfangreiche Finanzmittel zukommen, die in etwa die Hälfte der diesen Staaten insgesamt geleisteten Hilfen ausmachte. Acht der zehn genannten Staaten wurden am 1. Mai 2004 in die EU aufgenommen; Bulgarien und Rumänien folgten am 1. Januar 2007 als EU-Vollmitglieder. Nach dem Machtwechsel in Jugoslawien im Oktober 2000 schloss die EU im November 2000 auch ein umfangreiches Abkommen über gegenseitige Zusammenarbeit, in dessen Rahmen die EU Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro, verteilt auf fünf Jahre, zusagte. 3.3 Europa-Mittelmeer-Abkommen Weitere Assoziierungsabkommen, d. h. besonders enge Kooperationsverhältnisse (jedoch ohne automatische Beitrittsoption), hat die EU mit Malta (in Kraft seit 1971; seit 2004 EU-Mitglied), der Türkei (1964; Zollunion seit 1996), Tunesien (1998) und Zypern (1973; seit 2004 EU-Mitglied) geschlossen sowie mit Israel (1995 unterzeichnet), Jordanien (1997), Marokko (1996) und der Palästinensischen Autonomiebehörde (1997; Interimsabkommen). Diese Assoziierungsabkommen bilden den Kern der ,,EuropaMittelmeer-Partnerschaft" zwischen der EU und zwölf Staaten des Mittelmeerraumes: den genannten sieben und Algerien, Ägypten, Libanon, Syrien und - seit 1999 - Libyen sowie der Palästinensischen Autonomiebehörde. Im so genannten Barcelona-Prozess - benannt nach der Gründungskonferenz der Partnerschaft in Barcelona 1995 - soll die Kooperation zwischen der EU und den Mittelmeerstaaten sukzessive ausgebaut werden, vor allem die wirtschaftliche, die 2010 in der Verwirklichung einer Freihandelszone münden soll; aber auch die politische, sicherheitspolitische, kulturelle und humanitäre Zusammenarbeit soll vertieft werden. Allerdings erzielte die Europa-MittelmeerPartnerschaft in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens noch kaum Fortschritte, weder in wirtschaftlicher noch in politischer Hinsicht. 3.4 Lomé-Abkommen, Afrika Ebenfalls besondere Beziehungen unterhält die EU zu den so genannten AKP-Staaten, unterdessen 71 Staaten in Afrika, der K aribik und dem Pazifik, vorwiegend Entwicklungsländer. Die Lomé-Abkommen zwischen der EG bzw. der EU und den AKP-Staaten - das erste datiert von 1975, das vierte und bisher letzte trat 1990 in Kraft und lief 2000 aus - gewähren den beteiligten Entwicklungsländern zollfreien Zugang zum EU-Markt für nahezu alle ihre gewerblichen und Agrarprodukte, stellen den AKPStaaten beträchtliche Ausgleichzahlungen zur Stabilisierung der Exporterlöse sowie weitere Finanzmittel zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Lomé-Abkommen liegt auf der entwicklungspolitischen Dimension, wobei die Entwicklungshilfe für den wirtschaftlichen Sektor mit umfangreichen technischen, humanitären, sozialen und auf den Aufbau demokratischer, rechtsstaatlicher Strukturen konzentrierten Programmen verknüpft ist. Bei Nichteinhaltung politischer Elemente der Abkommen, z. B. bei Verletzung der Menschenrechte, kann die Zusammenarbeit suspendiert werden. Im Juni 2000 unterzeichneten die AKP-Staaten sowie sechs weitere Staaten bzw. Gebiete im Pazifik und die EU als Nachfolgevereinbarung für die Lomé-Abkommen das Cotonou-Abkommen (benannt nach dem Unterzeichnungsort Cotonou in Benin). Das Abkommen trat im April 2003 in Kraft und ist auf 20 Jahre angelegt. Vorrangige Ziele des Cotonou-Abkommens sind die Bekämpfung der sich kontinuierlich ausbreitenden Armut, die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung in den AKP-Staaten sowie die Heranführung der AKP-Staaten an bzw. ihre Integration in die Weltwirtschaft. Dabei wird mehr noch als beim letzten Lomé-Abkommen besonderer Wert auf umfassende Konzepte gelegt, die neben der wirtschaftlichen auch die politische, soziale, kulturelle und ökologische Entwicklung fördern. Die Achtung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind als Verpflichtungen in dem Abkommen festgeschrieben. Im April 2000 fand ein erstes Gipfeltreffen aller afrikanischer Staaten (mit Ausnahme Somalias) mit den Staaten der EU statt. Die wichtigsten Ergebnisse des Treffens waren die Institutionalisierung der Konferenz, die Begründung einer strategischen Partnerschaft sowie ein Aktionsplan, mit dessen Hilfe die Armut in Afrika in den folgenden 15 Jahren um die Hälfte reduziert werden soll; die Beschlüsse zeitigten jedoch kaum praktische Wirkung. Ein weitgehender Schuldenerlass, wie ihn die afrikanischen Staaten forderten und der wesentlich zur Überwindung der Armut und zur Entwicklung Afrikas beitragen könnte, wurde von der EU jedoch abgelehnt; lediglich Deutschland und Frankreich erklärten sich dazu bereit, einige bilaterale Schulden zu erlassen. Erst im Dezember 2007 folgte ein zweites Gipfeltreffen. Auf ihm wurde die strategische Partnerschaft bekräftigt sowie weitere Aktionspläne u. a. in Bezug auf Umweltschutz, Aufbau demokratischer Strukturen und Friedenssicherung beschlossen. Ein neues Handelsabkommen, das auf Betreiben der Welthandelsorganisation (WTO), die die Begünstigungen der AKP-Staaten bei Importen nach Europa moniert hatte, ausgearbeitet worden war und das die Handelsbedingungen für die AKP-Staaten verschlechtert hätte, lehnten die meisten der afrikanischen Staaten allerdings ab. 3.5 Asien, Lateinamerika und ehemalige Sowjetunion Mit den ASEAN-Staaten unterhält die EU auf der Basis eines 1980 geschlossenen Kooperationsabkommens enge Wirtschaftsbeziehungen. Dem Ausbau der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen der EU und Asien dient das 1996 institutionalisierte Asien-Europa-Gipfeltreffen ( Asia Europe Meeting, ASEM) der damals sieben ASEAN-Staaten plus China, Japan und Südkorea sowie der EU-Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission. Erweiterte Kooperationsabkommen schloss die EU in den neunziger Jahren zudem mit Indien, Sri Lanka, Vietnam, Nepal, Laos und Kambodscha. In den neunziger Jahren vertiefte die EU auch ihre Beziehungen zu Lateinamerika kontinuierlich: 1995 schloss die EU mit den Mercosur-Staaten ein Rahmenabkommen für den Ausbau ihrer Beziehungen zu einer politischen und wirtschaftlichen Assoziierung; seit 1993 besteht ein erweitertes, die Entwicklungspolitik betonendes Kooperationsabkommen mit der Andengemeinschaft; seit 1990 unterhält die EU einen regelmäßigen Dialog mit der Rio-Gruppe, in dem neben wirtschaftspolitischen Themen die Bekämpfung von Drogenanbau und -handel im Vordergrund stehen; und auch mit den Staaten Zentralamerikas steht die EU in regelmäßigem Dialog, institutionalisiert in den so genannten San-José-Konferenzen. Die Staaten Lateinamerikas, insbesondere die den ärmsten Entwicklungsländern gleichgestellten Staaten der Andengemeinschaft und Zentralamerikas, genießen für zahlreiche ihrer Güter zollfreien Zugang zum EU-Markt. Im Juni 1999 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU sowie der Länder Süd- und Mittelamerikas auf einem Gipfeltreffen in Rio de Janeiro auf eine schrittweise Liberalisierung des transatlantischen Handels; zudem beschlossen EU und Mercosur den Abbau von Zöllen mit der Perspektive der Schaffung einer Freihandelszone. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schloss die EU mit den GUS-Staaten (außer Tadschikistan) Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, in deren Mittelpunkt die Unterstützung der wirtschaftlichen und politischen Reformen in den GUS-Staaten steht. Finanzmittel zur Unterstützung des Transformationsprozesses fließen im Rahmen des TACIS-Programms (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) in die GUS-Staaten. 3.6 Vereinigte Staaten Die Beziehungen zwischen der EU und den USA gründen auf großer gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit - die EU ist der wichtigste Handels- und Investitionspartner der USA und umgekehrt - und auf einem breiten Interessen- und Wertekonsens. 1990 riefen EU und USA durch die ,,Transatlantische Erklärung" regelmäßige, halbjährliche Konsultationen auf höchster politischer Ebene ins Leben; 1995 erweiterten sie dieses primär beratende Gremium durch die ,,Neue Transatlantische Agenda" in ein Aktionsbündnis mit Schwerpunkt auf den folgenden vier Bereichen: Förderung von Frieden, Stabilität und Demokratie weltweit; Bewältigung globaler Herausforderungen (wie z. B. organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Umweltschutz); Ausweitung des Welthandels und Abbau von Handelshemmnissen sowie Intensivierung der transatlantischen Kontakte auf verschiedenen Ebenen. In der so genannten ,,Bonner Erklärung" von 1999 bekundeten beide Seiten ihren Willen, als gleichberechtigte Partner auf die Lösung regionaler Konflikte wie globaler Fragen hinzuwirken, so etwa auf die Lösung der Konflikte in Südosteuropa und im Nahen Osten. Aber obwohl die EU und die USA in der Bonner Erklärung die oberste Zuständigkeit der Vereinten Nationen bei der Friedenssicherung ausdrücklich anerkannten, stellte gerade ihre Rolle im KosovoKonflikt jenes Bekenntnis stark in Frage. Auf wirtschaftlicher Ebene schlossen die EU und die USA 1998 die ,,Transatlantische Wirtschaftspartnerschaft", durch die sowohl im gegenseitigen Verhältnis als auch innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) die Öffnung der Märkte vorangetrieben werden soll. Dessen ungeachtet werden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA immer wieder durch Handelskonflikte irritiert. 3.7 Beitrittsländer Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks stellten die zehn mittel- und osteuropäische Staaten des ,,Europa-Abkommens" Beitrittsgesuche zur EU: Ungarn und Polen 1994, Rumänien, die Slowakei, Lettland, Estland, Litauen und Bulgarien 1995, die Tschechische Republik und Slowenien 1996. Zuvor schon hatten Beitrittsgesuche gestellt: die Türkei (1987; 1997 suspendierte die Türkei, die nach Ansicht der EU vor allem die politischen Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht erfüllte, den Dialog mit der EU; 1999 erhielt die Türkei wieder offiziell den Status eines Beitrittskandidaten), Zypern (1990), Malta (1990; 1996 zog Malta sein Gesuch zurück, erneuerte es jedoch im September 1998), die Schweiz (1992; ihr Antrag ruht seit dem ablehnenden Referendum zum EWR 1992; 2001 entschieden die Schweizer zudem in einer Volksabstimmung gegen die unverzügliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen) und Norwegen (1967; der Beitritt scheiterte bislang an Volksabstimmungen in Norwegen). 2003 reichte schließlich noch Kroatien ein Beitrittsgesuch ein. Am 31. März 1998 nahm die EU Beitrittsverhandlungen mit zunächst sechs der beitrittswilligen Länder auf: mit Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik, Slowenien und Zypern; im Februar 2000 folgte der Beginn der Beitrittsverhandlungen mit sechs weiteren Kandidaten: Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, der Slowakei und Malta. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der EU sind allgemein innere Stabilität, demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung und Achtung der Menschenrechte, eine funktionierende Marktwirtschaft sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, den Verpflichtungen und Zielen, die aus einer EU-Mitgliedschaft resultieren, nachzukommen; darüber hinaus muss das beitrittswillige Land den Großteil der etwa 20 000 Rechtsakte der EU übernehmen bzw. die eigene Rechtsordnung dem EU-Recht angleichen. Die EU unterstützte den Beitrittsprozess der mittel- und osteuropäischen Länder durch das PHARE-Programm (Poland Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy), durch das vor allem der Aufbau der notwendigen Verwaltung und die für die Übernahme des EU-Rechts notwendigen Strukturen finanziert werden. Zur Vertiefung der Beziehungen der EU zu den Beitrittsländern institutionalisierte die EU Ende 1997 die so genannte Europakonferenz der Staats- und Regierungschefs bzw. Außenminister der EU-Staaten und der Beitrittsländer, die erstmals im März 1998 stattfand (ohne Beteiligung der Türkei). Die Europakonferenz diente in erster Linie der politischen Konsultation und behandelte Fragen von beiderseitigem Interesse, so z. B. Themen aus den Bereichen GASP und JI. In einem Zwischenbericht bescheinigte die Europäische Kommission Ende 2001 allen zwölf Kandidaten, mit denen Beitrittsverhandlungen geführt wurden, gute Fortschritte und stellte zehn der Kandidaten (Bulgarien und Rumänien waren ausgenommen) eine Aufnahme in die EU für das Jahr 2004 in Aussicht. Auf dem EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen im Dezember 2002 wurden die Beitrittsverhandlungen mit diesen zehn Ländern abgeschlossen, und nach Unterzeichnung und Ratifizierung der Beitrittsverträge wurden diese Länder am 1. Mai 2004 in der größten Erweiterungsrunde in der Geschichte der Gemeinschaft in die EU aufgenommen. Im Dezember 2004 beschloss der Europäische Rat, im Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufzunehmen, nachdem festgestellt worden war, dass die Türkei die politischen und wirtschaftlichen Kriterien für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt. Zuvor hatte sich bereits das Europäische Parlament für die Aufnahme von Verhandlungen ausgesprochen, obwohl der Beitritt der Türkei in die EU so umstritten ist wie bis dahin der keines anderen Landes. Ehe am 3. Oktober 2005 die auf eine Dauer von 10 bis 15 Jahren veranschlagten Beitrittsverhandlungen begonnen werden konnten, mussten jedoch noch zwei wesentliche Punkte geklärt werden: Die Türkei verweigerte nach wie vor dem EU-Mitglied Zypern die Anerkennung, erklärte sich schließlich aber doch bereit, Zypern bereits während der Beitrittsverhandlungen anzuerkennen und nicht erst kurz vor dem Beitritt zur EU und außerdem das Protokoll zur Zollunion mit der EU ab 2006 in vollem Umfang auch auf Zypern anzuwenden. Der zweite noch zu klärende Punkt war der Verhandlungsrahmen, gegen den Österreich unmittelbar vor Verhandlungsbeginn Einspruch erhob: Österreich wollte eine Alternative zu einer Vollmitgliedschaft - etwa in Form einer auch von den Unionsparteien in Deutschland favorisierten ,,privilegierten Partnerschaft" - in den Verhandlungsgrundlagen verankert sehen. Am Ende einigten sich die EU-Mitglieder auf eine Kompromisslösung, in der nur noch wenig von den österreichischen Forderungen enthalten war und in der u. a. festgelegt wurde, dass auch die Aufnahmefähigkeit der EU für neue Mitglieder als Kriterium bei der Entscheidung über die Aufnahme der Türkei eine wichtige Rolle spielen soll. Ebenfalls am 3. Oktober 2005 trat die EU in Beitrittsverhandlungen mit Kroatien ein. Der Beginn dieser Gespräche war ein halbes Jahr zuvor verschoben worden, da das Land bei der Verfolgung von Kriegsverbrechern nicht im erforderlichen Maße mit dem Internationalen Tribunal für Verbrechen im früheren Jugoslawien (ICTY) zusammenarbeitete. Jetzt jedoch bescheinigte das Tribunal Kroatien überraschend ,,uneingeschränkte Zusammenarbeit", woraufhin sogleich die Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden. Insbesondere Österreich hat großes Interesse an einer möglichst zügigen Aufnahme Kroatiens in die EU. Im Dezember 2005 erkannte die EU schließlich auch der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien den Status eines Beitrittskandidaten zu, ohne sich jedoch auf einen Termin für den Beginn von Beitrittsverhandlungen festzulegen. 4 GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN UNION Die Wurzeln der EU reichen in die Jahre unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg zurück, wenngleich die Idee eines politisch geeinten und vor allem friedlichen Europa wesentlich älter ist (siehe Europapläne). Erste konkrete Formen nahm die europäische Einigung 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, Montanunion) an - wenn auch nur in einem begrenzten wirtschaftlichen Bereich und in kleinem Rahmen. Gründungsmitglieder waren lediglich sechs europäische Staaten: Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Initiatoren der EGKS waren vor allem Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland in Person des französischen Außenministers Robert Schuman, der 1950 im so genannten Schumanplan die Errichtung einer deutsch-französischen Montanunion angeregt hatte, und des französischen Wirtschaftspolitikers Jean Monnet, der wesentlich zur Realisierung der EGKS beitrug und erster Präsident ihrer Hohen Behörde war, sowie nicht zuletzt in Person des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, der durch die Einbindung der Bundesrepublik in diese Gemeinschaft die wirtschaftliche und politische Westintegration der jungen Bundesrepublik zu vertiefen und den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Westdeutschlands voranzutreiben suchte. Mit In-Kraft-Treten der EGKS 1952 nahm auch die ,,Gemeinsame Versammlung" der EGKS, die Vorläuferin des Europäischen Parlaments, die Arbeit auf. 4.1 Die Europäischen Gemeinschaften 1955 beschlossen die Außenminister der sechs EGKS-Staaten, die Integration ihrer Länder über die Bereiche Kohle und Stahl hinaus auf weitere Bereiche der Wirtschaft auszuweiten. Am 25. März 1957 gründeten die sechs Staaten mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge - des zweiten Vertragswerkes in Richtung auf die Europäische Union - die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM). Als Ziel der EWG definierte der Vertrag die ,,Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten"; als langfristige Perspektive nannte der Vertrag einen ,,immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker", also eine - noch wenig klar umrissene - politische Union. Die Römischen Verträge traten am 1. Januar 1958 in Kraft. Mit In-Kraft-Treten des Fusionsvertrags am 1. Juli 1967 schlossen sich EGKS, EWG und EURATOM organisatorisch zu den Europäischen Gemeinschaften zusammen, d. h., sie legten ihre jeweils eigenen supranationalen Organe wie etwa Kommissionen und Ministerräte zusammen, blieben aber formalrechtlich weiterhin als eigenständige Organisationen bestehen. Die Fusion bedeutete einen weiteren Schritt in Richtung Integration. Am 1. Juli 1968 hatte die EWG mit der Verwirklichung der Zollunion die wesentliche Grundlage für die Errichtung des gemeinsamen Marktes geschaffen: Schrittweise waren alle Zölle sowie Einfuhrbeschränkungen zwischen den EWG-Staaten abgeschafft und einheitliche Zolltarife für den Handel mit Drittländern eingeführt worden. Die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die EWG als die umfassendste der drei Gemeinschaften (mit der im allgemeinen Sprachgebrauch die EG meist auch gleichgesetzt wurde), fungierte von Anfang an als Motor der europäischen Einigung, zunächst vordringlich auf wirtschaftlichem Gebiet, aber immer mit dem Fernziel einer politischen Union ihrer Mitgliedsländer. Dies ging jedoch zunächst einigen der westeuropäischen, noch nicht der EWG angehörenden Staaten zu weit; insbesondere Großbritannien fürchtete für den Fall eines EWG-Beitritts um seine nationale Souveränität. Auf Initiative Großbritanniens gründeten daher 1960 sieben, nicht der EWG angehörende europäische Staaten die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), deren wirtschaftspolitische Integrationsziele weit hinter denen der EWG zurückblieben. Der schon in der Anfangsphase sichtbare wirtschaftliche Erfolg der EWG veranlasste jedoch schrittweise einige der EFTA-Mitglieder, ihre Entscheidung zu überdenken und einen Beitritt zur EWG bzw. EG anzustreben. Bereits 1961 stellte Großbritannien einen ersten Aufnahmeantrag, der jedoch vorerst u. a. an wirtschafts- und außenpolitischen Vorbehalten Frankreichs scheiterte. Einem zweiten Beitrittsgesuch 1967 folgte 1973 die Aufnahme Großbritanniens in die EG; zugleich wurden Dänemark und die Republik Irland aufgenommen. Aus dem ,,Europa der Sechs" war in einer ersten Erweiterungsphase das ,,Europa der Neun" geworden. Parallel zur Erweiterung nach außen bemühten sich die EG um eine Vertiefung der wirtschaftlichen Integration und Stabilität im Inneren. Am 21. März 1972 trat der Europäische Währungsverbund in Kraft, die so genannte Währungsschlange, die die maximale Schwankungsbreite zwischen den Wechselkursen der Mitgliedsstaaten auf 2,25 Prozent festlegte. Sieben Jahre später, am 13. März 1979, löste das Europäische Währungssystem den Währungsverbund ab. Zugleich mit dem Währungssystem wurde die Währungseinheit ECU eingeführt, an der sich die Leitkurse der Währungen der Teilnehmerstaaten zu orientieren hatten. Der Europäische Währungsverbund, mehr noch das Europäische Währungssystem waren wesentliche Voraussetzungen für die Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) hatte in den sechziger Jahren deutliche Fortschritte gemacht und sich auf der Grundlage der Agrarmarktordnungen zu einem der wesentlichen Elemente der wirtschaftlichen Integration entwickelt. Seit den siebziger Jahren führte der Dualismus der beiden vordringlichen Ziele der GAP - kostengünstige Versorgung mit Lebensmitteln bei gleichzeitiger Einkommenssicherung für die Landwirte - jedoch zu einer Kostenexplosion, erwies sich als kaum mehr finanzierbar und ging vielfach zu Lasten anderer, ebenfalls wichtiger Gemeinschaftsaufgaben. Auch die politische Integration wurde in den siebziger Jahren - wenn auch weniger engagiert als die wirtschaftliche - weiter vorangebracht: 1970 führten die sechs EGStaaten die informelle Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) zur Abstimmung ihrer Außenpolitik ein; 1972 nannten die Staats- und Regierungschefs der EG erstmals ausdrücklich die Schaffung einer ,,Europäischen Union", d. h. einer politischen Union, als langfristiges Ziel; und 1974 institutionalisierten die Staats- und Regierungschefs der EG ihre Gipfeltreffen als regelmäßig tagenden Europäischen Rat. 1979 wurde schließlich das Europäische Parlament erstmals direkt von der Bevölkerung der EG-Länder gewählt; in den Jahren zuvor hatte es bereits eine - bescheidene - Ausweitung seiner Kompetenzen erfahren. 1981 wurde Griechenland in die EG aufgenommen, und 1986 kamen Spanien und Portugal als weitere Mitglieder hinzu. Durch diese ,,Süderweiterung" sah sich die EG mit großen Herausforderungen konfrontiert: Die neu beigetretenen Länder, vor allem Griechenland und Portugal, waren wirtschaftlich deutlich weniger entwickelt als die ,,alten" neun EG-Länder; die allmähliche Angleichung ihrer Volkswirtschaften an das EG-Niveau war mit schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowohl für die drei neuen Mitglieder wie für die EG insgesamt verbunden. Die EG hatten die Aufnahme der drei südeuropäischen Länder denn auch weniger wirtschaftlich als vor allem politisch begründet: Durch ihre Einbindung in die EG sollte die Demokratisierung und politische Stabilisierung in Griechenland, Spanien und Portugal nach dem Ende der autoritären Regimes unterstützt werden. 4.2 Vertiefung der Integration In den achtziger Jahren intensivierten die EG ihre Bemühungen um eine Vertiefung der politischen und eine raschere Umsetzung der wirtschaftlichen Union. Nach Initiativen sowohl des Europäischen Parlaments wie des Europäischen Rates erarbeiteten die EG-Mitgliedsstaaten die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die im Februar 1986 unterzeichnet wurde und am 1. Juli 1987 in Kraft trat. Als übergeordnetes Ziel der EG definierte die Präambel der EEA, ,,das von den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften ausgehende Werk weiterzuführen und die Gesamtheit der Beziehungen zwischen deren Staaten ... in eine Europäische Union umzuwandeln". Die EEA änderte und ergänzte erstmals die EG-Gründungsverträge tief greifend: In ihrem Mittelpunkt stand die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes mit den ,,vier Freiheiten" (freiem Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr), die bis Ende 1992 erreicht werden sollte, die Festlegung auf die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion und die Erweiterung der EG-Verträge um die Bereiche Umwelt, Forschung und Technologie als gemeinsame Politikfelder der Gemeinschaft. Zudem legten sich die EG-Mitglieder durch die Aufnahme der bisher informellen EPZ in den Vertrag auf die Zusammenarbeit in der Außenpolitik fest. Flankiert wurden diese Maßnahmen zum Umbau der EG zu einer Europäischen Union durch institutionelle Reformen: Das Europäische Parlament erhielt erweiterte legislatorische Befugnisse, und die Entscheidungsverfahren im Ministerrat wurden für einige Bereiche vereinfacht. Am 1. Januar 1990 trat die erste Stufe der in der EEA konkretisierten Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft. In dieser ersten Phase sollte der freie Kapitalverkehr zwischen den EG-Mitgliedsstaaten verwirklicht und die Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik der Mitglieder möglichst eng koordiniert werden, um eine hohe Preis- und Wechselkursstabilität zu erreichen. Am 1. Januar 1993 trat der europäische Binnenmarkt mit freiem Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr in Kraft. Im Juni 1990 unterzeichneten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten das Schengener Abkommen zur Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und zur Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Asylpolitik; die übrigen EG-Staaten außer Großbritannien und Irland traten dem Abkommen in den Folgejahren bei. Nach und nach umgesetzt wurde das Abkommen allerdings erst ab 1995. Das Schengener Abkommen war zunächst nicht Bestandteil der EG-Verträge, war aber von vornherein als wesentliches Element für die Errichtung des Binnenmarktes und der Europäischen Union gedacht. Erst durch den Vertrag von Amsterdam wurde das Abkommen integraler Bestandteil der EU. 4.3 Die Europäische Union Der am 7. Februar 1992 von den Staats- und Regierungschefs der EG unterzeichnete und am 1. November 1993 in Kraft getretene Vertrag von Maastricht markierte einen Qualitätssprung in der Entwicklung der EG: Durch die Erweiterung der EG um die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, d. h. durch den vertraglich fixierten Ausbau der politischen Integration, wurde aus den primär wirtschaftlich orientierten EG die wirtschaftlich und politisch definierte Europäische Union. Kernpunkt des Vertrags von Maastricht war die Festlegung auf den Ausbau des Binnenmarktes zur Wirtschafts- und Währungsunion einschließlich der Einführung einer einheitlichen Währung bis zum Jahr 1999 und zugleich die Errichtung einer politischen Union. Ein weiterer wichtiger Punkt des EUVertrags war die Einführung der Unionsbürgerschaft für alle Bürger der EU in Ergänzung der jeweils nationalen Staatsbürgerschaft. Der Vertrag von Maastricht war nach der EEA die zweite grundlegende Änderung und Erweiterung der EG-Verträge, und ebenso wie die EEA reformierte auch der EU-Vertrag das institutionelle Gefüge der Gemeinschaft in Richtung auf mehr demokratische Kontrolle und Mitentscheidung, Transparenz und Effektivität. Am 1. Januar 1994 trat die zweite Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft, in der unter der Leitung des neu geschaffenen Europäischen Währungsinstituts die geldpolitischen und technischen Voraussetzungen für die Währungsunion geschaffen werden sollten. Am 1. Januar 1995 wurden Finnland, Österreich und Schweden Mitglieder der EU. Zum 1. Januar 1999 trat mit der Einführung des Euro in elf der 15 Mitgliedsstaaten die dritte und letzte Stufe der Währungsunion in Kraft. Am 2. Oktober 1997 unterzeichneten die 15 Mitgliedsstaaten der EU den Vertrag von Amsterdam (in Kraft getreten am 1. Mai 1999), der den Vertrag von Maastricht revidierte und die Grundlage für die Weiterentwicklung der EU - sowohl die innere als auch die Erweiterung der EU um neue Mitglieder - bildet. Im Mittelpunkt des Vertrags von Amsterdam steht die Ausgestaltung der politischen Union, d. h. die Vertiefung der GASP zu einer kohärenten und effizienten Außenpolitik, und die Schaffung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch die Intensivierung der JI. Vor allem aber setzt sich die EU im Vertrag von Amsterdam die Verwirklichung einer ,,Union der Bürger" zum Ziel, d. h., es sollen nicht nur die Menschen- und Bürgerrechte in der Union gestärkt und die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU transparenter und bürgernäher gestaltet werden, sondern es werden auch Bereiche wie die Sozial- und Beschäftigungspolitik, die Umwelt- und Gesundheitspolitik deutlich aufgewertet. Auch die Organe der EU wurden durch den Vertrag von Amsterdam erneut reformiert, zum Teil gestärkt und effizienter gestaltet. Besonders das Europäische Parlament gewann durch den Vertrag von Amsterdam: Seine Gesetzgebungskompetenz und Kontrollfunktion wurde erheblich erweitert; es bleibt aber, im Vergleich etwa zu den Volksvertretungen in den EU-Mitgliedsstaaten, weiterhin ein relativ schwaches Organ. 5 PERSPEKTIVEN Besonders die Beitrittsgesuche der zehn mittel- und osteuropäischen Staaten des Europa-Abkommens stellen die EU vor immense Herausforderungen, sowohl strukturelle und institutionelle wie finanzielle. Angesichts dieser Herausforderungen erarbeitete die Kommission im Auftrag des Europäischen Rates Vorschläge für die im Hinblick auf eine Erweiterung notwendige Reformen der EU sowie für die konkreten Schritte zur Erweiterung und erstellte einen Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006. Das Ergebnis ihrer Arbeit legte die Kommission im Juli 1997 in Form der Agenda 2000 vor. Einen Schwerpunkt der Agenda bildete die Reform der Agrarpolitik, die, würde sie unverändert weitergeführt, nach der Osterweiterung der EU deren Finanzrahmen vollends sprengen würde; zudem widersprach das Subventions- und Garantiepreissystem der EUAgrarpolitik den Regeln des freien Welthandels. Des Weiteren enthielt die Agenda Vorschläge zu einer neuen Heranführungsstrategie der Beitrittskandidaten an die EU in Form einer so genannten Beitrittspartnerschaft und befasste sich mit dem Problem der Gewährleistung der wirtschaftlichen und sozialen Standards unter den Bedingungen einer Osterweiterung. Zur notwendigen Reform der Organe der EU, sowohl was ihre jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen als auch ihre künftige Größe, Zusammensetzung und Struktur betraf, äußerte sich die Agenda ebenfalls detailliert. Als größtes Hindernis für eine Einigung der 15 EU-Staaten über die Agenda 2000 erwies sich der in der Agenda vorgestellte Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006, der insbesondere bei den Agrarausgaben und der Regionalförderung Kürzungen und Umschichtungen vorsah. Erst nach langwierigen Verhandlungen konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU im März 1999 auf eine modifizierte Agenda 2000 einigen, die deutlich hinter den von der Kommission vorgeschlagenen Kürzungen im Agrarhaushalt zurückblieb und auch die Erwartungen einiger Mitglieder hinsichtlich der Neuverteilung der Finanzlasten nicht erfüllen konnte, die aber dennoch mittelfristig die Erweiterungsfähigkeit der EU gewährleistete. Dass eine tief greifende Reform der Organe der EU, wie sie die Kommission in der Agenda 2000 auch für die eigene Behörde vorgeschlagen hat, dringend notwendig war, erwies sich im März 1999, als die EU durch den Rücktritt der gesamten Kommission in ihre bislang schwerste Krise geriet. Vorausgegangen waren Vorwürfe der Korruption und der Vetternwirtschaft gegen einige der 20 Kommissare, allen voran gegen die französische Kommissarin Edith Cresson, sowie ein gescheiterter Misstrauensantrag des Europäischen Parlaments gegen die Kommission. Als problematisch erwies sich dabei, dass die Kommission als Kollektivorgan agiert, d. h. auch nur als Kollektiv abgesetzt werden kann; Misstrauensanträge gegen einzelne Kommissare sind nicht vorgesehen. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum wurde der so genannte ,,Rat der fünf Weisen" eingesetzt, der rückhaltlos aufklären sollte, inwieweit sich die EU-Kommission für Misswirtschaft, Betrug und Korruption zu verantworten habe. In ihrem Abschlussbericht bestätigten die ,,Fünf Weisen" die Vorwürfe der Korruption und der Vetternwirtschaft gegen einige der Kommissare und bescheinigten den 20 Kommissaren kollektives Versagen sowie mangelndes Verantwortungsbewusstsein und Missmanagement. Die Kommission unter der Führung ihres Präsidenten Jacques Santer zog die Konsequenz und trat am 16. März 1999 geschlossen zurück, blieb jedoch bis zur formellen Ernennung der neuen Kommission unter Romano Prodi im September 1999 kommissarisch im Amt. Die bereits im Vertrag von Amsterdam und in der Agenda 2000 angelegte Reform der Kommissionsspitze sowie der in ihren Strukturen nahezu undurchschaubar gewordenen Gesamtbehörde mit ihren damals etwa 20 000 Mitarbeitern erhielt durch die Krise um die Kommission neue Brisanz, ebenso die Forderungen nach einer Erweiterung der Kontrollfunktionen des Parlaments. Die neue Kommission leitete unmittelbar nach ihrem Amtsantritt tief greifende Reformen der eigenen Behörde ein; der Reformprozess verlor jedoch rasch an Schwung und beschränkte sich zunächst im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Dienste und Generaldirektionen der Kommission. Im Februar 2000 nahm eine Regierungskonferenz die Arbeit auf, die Vorschläge für eine grundlegende institutionelle Reform der gesamten EU in Hinblick auf die geplante Erweiterung erarbeiten sollte. Sie befasste sich u. a. mit der Frage nach der zukünftigen Größe und Zusammensetzung der Kommission sowie der anderen Organe der EU, mit dem Problem der zukünftigen Stimmengewichtung im Ministerrat und einer eventuellen Ausweitung der Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zulasten der einstimmigen Beschlüsse und mit der Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit und eines rascheren Voranschreitens einzelner Mitglieder in bestimmten Bereichen, der so genannten Flexibilitätsklausel. Im Dezember 2000 verabschiedete der EU-Gipfel dann im Vertrag von Nizza entsprechende Reformen: die Neujustierung der Machtverhältnisse im Ministerrat, die Neuverteilung der Kommissarsposten (zunächst pro Mitgliedsland ein Kommissar), die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen sowie die Festschreibung des Flexibilitätsprinzips. Außerdem einigte sich der Gipfel auf den so genannten Post-Nizza-Prozess, d. h. eine weitere Reformrunde im Jahr 2004. Ihren sicherheitspolitischen Führungsanspruch in Europa, dessen mangelhafte Umsetzung im Rahmen des Kosovo-Konfliktes deutlich erkennbar wurde, suchte die EU seit Beginn des NATO-Bombardements gegen Jugoslawien im März 1999 gerade in Reaktion auf ihr Versagen auf dem Balkan zu verwirklichen: Sie bemühte sich nachdrücklich um Vermittlung, übernahm nach Kriegsende die Führung im Balkan-Stabilitätspakt und leitete - unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges - den Aufbau handlungsfähiger und effektiver sicherheits- und verteidigungspolitischer Strukturen ein, installierte z. B. wie erwähnt den Hohen Beauftragten für die GASP und beschloss den Aufbau einer europäischen Eingreiftruppe (siehe oben Abschnitt 2.2.). Im Januar 2003 begann die EU ihren ersten internationalen Kriseneinsatz: Sie entsandte eine 500 Mann starke Polizeimission nach Bosnien-Herzegowina und löste dort die UN-Friedenstruppen ab. Parallel zu den außen- und sicherheitspolitischen Aktivitäten unternahm die EU auch ,,innenpolitisch" weitere Schritte zur europäischen Einigung: Im Oktober 1999 wurde die Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraumes beschlossen, in dem Gerichtsurteile gegenseitig anerkannt, die gemeinsame Verbrechensbekämpfung forciert, die Rechtspolitiken der Mitgliedsstaaten einander angenähert und vor allem auch das Asylrecht vereinheitlicht werden soll. Zudem ließ die EU von einer Expertenkommission unter dem Vorsitz von Roman Herzog eine Grundrechtscharta ausarbeiten, die zum einen den Bürgern der EU Rechtssicherheit geben, zum anderen auch die noch immer teilweise wenig ausgeprägte Identifikation der Bürger mit der EU verstärken soll. Im Oktober 2000 legte die Kommission ihren Entwurf vor, im Dezember 2000 verabschiedete der EU-Gipfel in Nizza die Charta. Handlungsbedarf - auch im Hinblick auf die Osterweiterung der EU - ergab sich in der Frage nach den Befugnissen der EU gegenüber einzelnen Mitgliedsstaaten. Entzündet hatte sich die Diskussion, inwieweit sich die EU in innenpolitische Angelegenheiten eines ihrer Mitgliedsstaaten einmischen dürfe, an den Sanktionen, die die EU in Reaktion auf die Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen FPÖ gegen Österreich verhängte. Noch während ÖVP und FPÖ im Januar 2000 in Österreich über eine Regierungszusammenarbeit verhandelten und noch bevor ein Koalitionsvertrag oder Regierungsprogramm der beiden Parteien vorlag, drohte die EU-Ratspräsidentschaft für den Fall einer Regierungsbeteiligung der FPÖ die politische Isolierung Österreichs an; unmittelbar nach der Vereidigung der ÖVP/FPÖ-Regierung Anfang Februar setzten die übrigen 14 EU-Staaten diese Drohung um und suspendierten ihre bilateralen Beziehungen zu Österreich. Zwar halten die EU-Verträge tatsächlich die Möglichkeit von Sanktionen gegen einzelne Mitgliedsstaaten offen - aber nur bei schweren Verstößen gegen die freiheitlichen, demokratischen, rechtsstaatlichen und die Menschenrechte garantierenden Grundprinzipien der EU. Und die waren der FPÖ im Koalitionsvertrag und im Regierungsprogramm nicht nachzuweisen, wohl aber den Äußerungen einzelner FPÖ-Politiker, allen voran Jörg Haider. Es stellte sich nun die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage die Sanktionen gegen Österreich fußten, ob es überhaupt ausreichende Rechtsgrundlagen für die Sanktionen gäbe, warum etwa die EU nicht auch auf die rechtspopulistische Regierung (mit neofaschistischer Beteiligung) in Italien unter Silvio Berlusconi 1994 mit Sanktionen reagiert hatte und wie in Zukunft in ähnlich gelagerten Fällen zu verfahren sei. Angesichts der mangelnden Legitimation ihrer Sanktionen und um ohne Gesichtsverlust die Sanktionen wieder aufheben zu können, entsandte die EU im Juli 2000 ,,drei Weise" nach Österreich, die die Situation der Grund- und Menschenrechte überprüfen sollten. In ihrem Abschlussbericht kamen die ,,drei Weisen" zu dem Ergebnis, dass keine Verstöße zu beobachten seien, rieten aber Wachsamkeit gegenüber der FPÖ an. Im September 2000 wurden die - völlig wirkungslosen - Sanktionen gegen Österreich aufgehoben. Als im Juni 2001 in Italien erneut Berlusconi die Regierung übernahm, wieder mit neofaschistischer Beteiligung, sah die EU von Sanktionen oder ähnlichen Reaktionen ab. Eine weitere Irritation erfuhr der Integrationsprozess der EU, als Dänemark im September 2000 in einer Volksabstimmung die Einführung des Euro ablehnte. Auch in anderem Zusammenhang sorgte das Thema ,,Volksabstimmung", die Einbeziehung von EU-Bürgern in EU-Entscheidungsprozesse, für Unstimmigkeiten, so etwa, als der Kommissar für die Erweiterung der EU, Günther Verheugen, für Deutschland ein Referendum über die Osterweiterung der EU vorschlug, oder als das mit Sanktionen belegte Österreich ultimativ die Abhaltung einer Volksabstimmung über die Sanktionen und die Osterweiterung zugleich androhte. Überhaupt bot die Osterweiterung immer wieder Anlass zu Spannungen und Konflikten zwischen den EU-Mitgliedern: So forderten etwa Deutschland und Österreich zum Schutz des eigenen Arbeitsmarktes eine bis zu siebenjährige Übergangsfrist bei der Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus den Beitrittsländern; die Kommission entsprach weitgehend dieser Forderung. Spanien verlangte aber für seine Zustimmung zu dieser Übergangsfrist bindende Zusagen für eine Fortführung der umfangreichen Zahlungen aus dem Strukturfonds an Spanien über das Ende des laufenden Finanzplans im Jahr 2006 hinaus. Einen neuerlichen Rückschlag erlebte der Reform- und Integrationsprozess, als Irland im Juni 2001 in einer Volksabstimmung den Vertrag von Nizza ablehnte (mit 54 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von lediglich 34 Prozent). In einer zweiten Abstimmung im Oktober 2002 nahmen die Iren den Vertrag jedoch mit 63 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent an, so dass der Vertrag am 1. Februar 2003 in Kraft treten konnte. Auf seinem Gipfeltreffen im belgischen Laeken leitete der Europäische Rat im Dezember 2001 bereits den Post-Nizza-Prozess ein, indem er einen ab März 2002 tagenden Konvent installierte, dessen Aufgabe es war, ,,die wesentlichen Fragen zu prüfen, welche die künftige Entwicklung der Union aufwirft, und sich um verschiedene mögliche Antworten zu bemühen". Zu den ,,wesentlichen Fragen" gehören laut der ,,Erklärung von Laeken" das Problem der Verteilung und Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedsländern, die Fülle der Rechtsinstrumente und wie sie verringert und vereinfacht werden können sowie die Frage, ob - längerfristig - die notwendige Neuordnung und Vereinfachung der Verträge nicht zwangsläufig zu einer Europäischen Verfassung führen könnte und was dann die Kernbestandteile einer solchen Verfassung sein müssten. Die ,,Erklärung von Laeken" formulierte die (potentiellen) Themen für den Konvent bewusst in Form von Fragen, um eine möglichst tabulose Debatte und eine kritische Beurteilung des gesamten Bestands der EU zu ermöglichen. Als oberstes Ziel jeder Reform und Neustrukturierung der EU forderte die ,,Erklärung von Laeken": ,,Die Union muss demokratischer, transparenter und effizienter werden." 5.1 Verfassung und Osterweiterung Am 1. Mai 2004 erfolgte die größte Erweiterung in der Geschichte der EU: Acht mittel- und osteuropäische Länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn) sowie Malta und Zypern wurden formell in die Union aufgenommen. Am 1. Januar 2007 wurden Bulgarien und Rumänien Vollmitglieder der EU; zugleich trat als erstes der 2004 aufgenommenen Länder Slowenien der Eurozone bei. Mit dem Beitritt der zwölf Länder war nach Ansicht zahlreicher EU-Politiker die Aufnahmekapazität der EU vorerst ausgeschöpft. Im Juli 2003 legte der Konvent seinen Entwurf einer Europäischen Verfassung vor, der den in Laeken formulierten Fragen Rechnung trug, aber naturgemäß Kompromisscharakter hatte und deutliche Spuren zahlreicher nationaler Einzelinteressen erkennen ließ. Die wesentlichen Elemente der Verfassung waren: Die Installierung eines ständigen, für zweieinhalb Jahre gewählten EU-Präsidenten anstelle der rotierenden Präsidentschaft; die Einführung des Amtes eines EU-Außenministers; die Begrenzung der Anzahl der Kommissare mit Stimmrecht auf 15 (ab 2009); die Ausdehnung des Mitentscheidungsrechts des Europäischen Parlaments; die Einführung des Mehrheitsprinzips in einer Reihe von Bereichen, in denen bisher bei Abstimmungen im Ministerrat Einstimmigkeit erforderlich war; eine klare Kompetenzordnung, die zwischen ausschließlich bei der EU liegenden Kompetenzen, zwischen EU und Mitgliedsstaaten geteilten und lediglich ergänzenden Kompetenzen der EU unterscheidet. Die geplante Verabschiedung der Verfassung auf dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates im Dezember 2003 scheiterte jedoch; Hauptstreitpunkt war hierbei die Stimmengewichtung im Rat der EU: Während die meisten EU-Mitglieder und -Beitrittskandidaten an der in dem Verfassungsentwurf vorgesehenen ,,doppelten Mehrheit" (bei Entscheidungen zählt nicht nur die Mehrheit der Stimmen im Rat, sondern diese Stimmen müssen auch die Mehrheit der EU-Bevölkerung vertreten) festhielten, bestanden Spanien und Polen auf den im Vertrag von Nizza eingeräumten Blockademöglichkeiten. Der Regierungswechsel in Spanien und der Rücktritt des polnischen Ministerpräsidenten im April bzw. Mai 2004 machten jedoch den Weg für eine rasche Einigung frei: Am 18. Juni 2004 verabschiedete der Europäische Rat den endgültigen Vertragstext der Europäischen Verfassung, und am 29. Oktober unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der 25 EU-Mitgliedsstaaten an historischem Ort - nämlich in jenem Saal im Kapitol in Rom, wo 1957 die Römischen Verträge unterzeichnet worden waren - die erste gemeinsame Europäische Verfassung. Kurz nach der Unterzeichnung der Europäischen Verfassung begann im November 2004 der Ratifizierungsprozess. Bis Mai 2005 hatten bereits zehn Länder die Verfassung ratifiziert, dann aber lehnten die Wähler in Frankreich und in den Niederlanden in Referenden die Verfassung ab (Mai/Juni 2005). In beiden Ländern waren neben Bedenken gegen die 2004 vollzogene sowie die künftige Erweiterung der EU allerdings auch innenpolitische Gründe in die Abstimmungsergebnisse eingeflossen. Die Krise, die diese negativen Voten heraufbeschworen, konnten auch die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen im Juni 2005 nicht beilegen, im Gegenteil: Die Verhandlungen über den Finanzrahmen der Etatperiode 2007 bis 2013 scheiterten, und zwar am Widerspruch Großbritanniens: Angesichts des Finanzbedarfs der erweiterten EU sollte Großbritannien Abstriche beim so genannten Britenrabatt hinnehmen. Dazu zeigte sich Großbritannien aber nur unter der Bedingung bereit, dass der Haushalt der EU grundlegend reformiert, d. h. insbesondere die Agrarausgaben der Union, die etwa 40 Prozent des Haushalts ausmachten, deutlich gekürzt würden. (Den Britenrabatt hatte 1984 Margaret Thatcher mit der damals berechtigten Begründung durchgesetzt, Großbritannien sei im Vergleich zu den anderen EG-Staaten wirtschaftlich schwach und erhalte wegen seiner kleinen Landwirtschaft zudem nur wenig Geld von der Gemeinschaft zurück. Seither bekam Großbritannien etwa zwei Drittel seiner Nettobeiträge an die EU wieder zurück.) Eine Lösung oder zumindest ein tragfähiger Kompromiss in der Finanzfrage kam nicht zustande. In Bezug auf die Verfassung beschloss der Rat, den Ratifizierungszeitraum, der ursprünglich im Herbst 2006 beendet sein sollte, bis 2007 auszuweiten. Nach dem gescheiterten Gipfeltreffen entspann sich eine heftige Kontroverse über die Zukunft der EU: Solle sie lediglich ein gemeinsamer Markt unter wirtschaftsliberalen Vorzeichen werden (das anzustreben unterstellte man Großbritannien) oder eine politische Union? Großbritannien, das am 1. Juli 2005 die Ratspräsidentschaft übernahm, kündigte an, während seiner Präsidentschaft eine Diskussion über die Zukunft der EU in Gang setzen zu wollen und eine tief greifende Reform des EU-Haushalts einzuleiten. Eine weiterführende Diskussion über die Zukunft der EU blieb in der Folge jedoch aus, und auch die Reform des Haushalts gelang nicht. Zumindest aber einigte man sich unter einigen Kompromissen auf einen Finanzrahmen für die Jahre 2007 bis 2013, der auch den Abbau des Britenrabatts und die Möglichkeit der Reform der Agrarpolitik beinhaltete. Erst unter der Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland im ersten Halbjahr 2007 wurde die Verfassungsfrage wiederbelebt: In der so genannten Berliner Erklärung, die in Berlin während der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge verabschiedet wurde, verständigte man sich darauf, ,,die Europäische Union bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 auf eine erneuerte gemeinsame Grundlage zu stellen". Das Wort ,,Verfassung" wurde in der Erklärung sorgfältig vermieden, um nicht von vornherein eine neue Diskussion über den umstrittenen Verfassungsvertrag auszulösen. Auf dem EU-Gipfel im Juni 2007 wurde die Europäische Verfassung schließlich endgültig ad acta gelegt. Stattdessen einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf die Grundlinien eines ,,Reformvertrags", der jedoch wesentliche Teile der Verfassung übernahm. Auseinandersetzungen, die zeitweise das Projekt erneut scheitern zu lassen drohten, gab es vor allem in Bezug auf die Stimmengewichtung, die von Polen unter seiner neuen Führung, den Brüdern Jaros?aw und Lech Kaczy?ski, wieder in Frage gestellt wurde, und in Bezug auf die Grundrechtecharta, die Großbritannien und Polen für sich als nicht bindend betrachteten. Als diese Streitpunkte ausgeräumt waren (in Form von Zugeständnissen bei der Stimmengewichtung und Ausnahmeklauseln zur Grundrechtecharta), konnte auf dem EU-Gipfel im Dezember 2007 in Lissabon der neue EU-Vertrag unterzeichnet werden. Verfasst von: Mechthild Weißer Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.