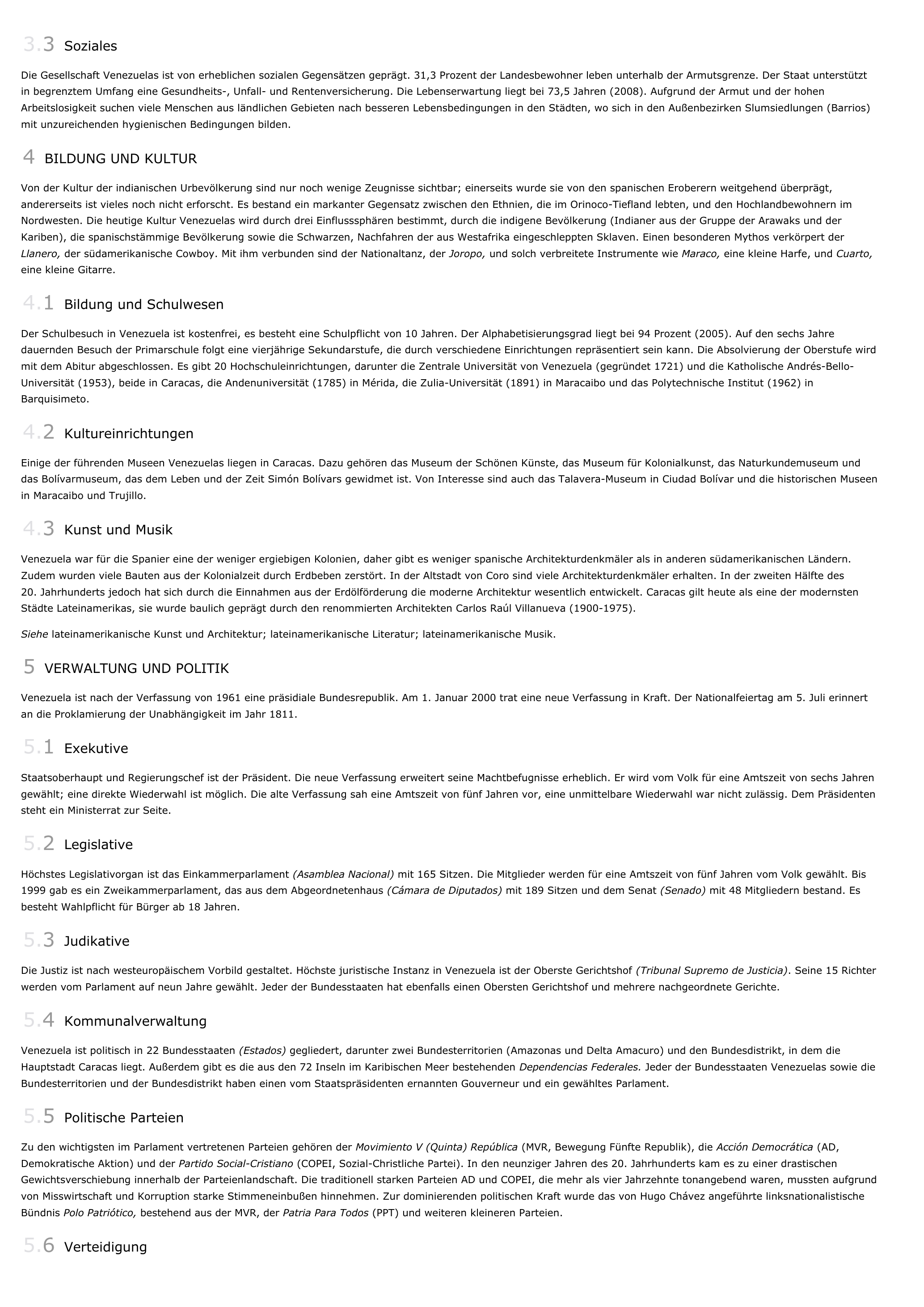Venezuela - geographie. 1 EINLEITUNG Venezuela (Bolivarische Republik Venezuela), Republik in Südamerika, grenzt im Norden an das Karibische Meer und den Atlantischen Ozean, im Osten an Guyana, im Süden an Brasilien und im Westen an Kolumbien. Venezuela beansprucht Teile des Staatsgebiets von Guyana. Die Küste von Venezuela ist etwa 2 800 Kilometer lang, und wird durch zahlreiche Buchten wie den Golf von Venezuela und den Golf von Paria gegliedert. Der Küstenstreifen ist überwiegend schmal, und greift nur im Westen weiter ins Land hinein. Die größte der etwa 70 venezolanischen Inseln ist Margarita. Die Landesfläche beträgt 916 445 Quadratkilometer. Hauptstadt der Republik ist Caracas. 2 LAND Venezuela liegt in den inneren Tropen und gliedert sich in drei Großräume: das Gebirgsland der Anden, das vom Orinoco durchflossene Tiefland und das Bergland von Guayana. Im äußersten Südwesten hat das Land außerdem noch Anteil am Tiefland des Amazonas. Im Nordwesten und Norden erstrecken sich die nordöstlichen Ausläufer der Anden. Die kolumbianische Kordillere spaltet sich auf venezolanischem Gebiet in die Sierra de Perijá und die Cordillera de Mérida auf. Hier befindet sich auch der höchste Gipfel des Landes, der Pico Bolívar (5 007 Meter). Beide Gebirgszüge umschließen die Senke von Maracaibo. Sie umfasst den Maracaibosee, eine Erweiterung des Golfs von Venezuela. Die Ausläufer der Anden setzen sich im Karibischen Küstengebirge fort, zu dem auch die Insel Margarita gehört. In der Landesmitte erstreckt sich das vom Orinoco durchflossene Tiefland mit den Llanos ( Flachland). Dieses tropische baumlose Grasland bildet ein leicht gegen Osten geneigtes Aufschüttungsgebiet, das zur Regenzeit großflächig überschwemmt ist. Im Südosten und Süden erstreckt sich vom Orinocodelta bis hinein nach Brasilien und Guyana das von Tafelbergen überragte Bergland von Guayana mit maximalen Höhen um 3 000 Meter. Die längsten Bergketten sind die Sierra Parima und die Sierra Pacaraima im Grenzgebiet zu Brasilien. Der Salto Ángel im östlichen Teil des Berglandes ist mit einer Fallhöhe von etwa 1 000 Metern der höchste Wasserfall der Erde. 2.1 Flüsse und Seen Venezuela hat sechs schiffbare Flüsse. Die allermeisten der insgesamt über 1 000 Flüsse sind Quell- oder Nebenflüsse des Orinoco, der etwa vier Fünftel des Landes entwässert. Über die Nebenflüsse Río Apure und Meta ist sogar das Landesinnere von Kolumbien mit dem Atlantischen Ozean verbunden. Durch die Bifurkation (Entwässerung in zwei Richtungen je nach Wasserführung) des Río Casiquiare ist der Orinoco über den Río Negro auch mit dem Flusssystem des Amazonas verbunden. 2.2 Klima In Venezuela herrscht tropisch-wechselfeuchtes Klima mit einer ausgeprägten Trockenzeit im Winter und einer sommerlichen Regenzeit, während der vor allem im Gebirge hohe Niederschlagsmengen erreicht werden. In den Anden und im Bergland von Guayana betragen die Jahresniederschläge in exponierten Lagen bis etwa 3 000 Millimeter. Im Tiefland nehmen die Jahresniederschläge von Osten (um 1 000 Millimeter) nach Westen (bis ca. 1 500 Millimeter) zu. In den küstennahen Gebieten ist es demgegenüber relativ trocken. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt in Caracas bei 833 Millimetern, in Maracaibo bei 577 Millimetern. Typisch für Länder mit Hochgebirgsanteil ist die Ausprägung von klimatischen Höhenstufen. Im Küstentiefland liegen die mittleren Jahrestemperaturen zwischen 25 und 28 °C, in 2 000 Meter Höhe zwischen 15 und 23 °C. 2.3 Flora und Fauna In Venezuela sind 62,9 Prozent (2007) der Gesamtfläche als geschützt ausgewiesen. Das Land verfügt somit über den höchsten Prozentsatz an Naturschutzgebieten in ganz Nord- und Südamerika. Im Vergleich dazu stehen in den Nachbarländern Venezuelas, Kolumbien, Brasilien und Guyana, nur jeweils 31,7 Prozent, 18,5 Prozent und 2,2 Prozent (2007) der Landesfläche unter Naturschutz. Wälder mit tropischen Pflanzen wie Palmen und Brasilholz bedecken gut ein Drittel der Fläche Venezuelas. Oberhalb 900 Metern wachsen auch Pflanzen der gemäßigten Zone. Die Llanos sind von Grasland bedeckt, im Orinocodelta sind Mangrovensümpfe verbreitet. Die Tierwelt ist überaus artenreich mit Säugetieren wie Jaguaren, Ozelots, Bären, Affen, Faultieren, Ameisenbären, Gürteltieren und Hirschen. Verbreitete Vogelarten sind u. a. Flamingos, Reiher, Ibisse und Fettschwalme. Zu den Reptilien gehören Krokodile und Riesenschlangen wie Anakondas und Boas. 3 BEVÖLKERUNG Venezuela hat 26,4 Millionen Einwohner (2008), die Bevölkerungsdichte liegt bei 30 Einwohnern je Quadratkilometer. Etwa 69 Prozent der Venezolaner sind Mestizen oder Mulatten (Mischlinge mit einem europäischen und einem indianischen bzw. negriden Elternteil), etwa 20 Prozent sind Weiße, 9 Prozent Schwarze, 2 Prozent der Einwohner sind Indianer. 88 Prozent der Bevölkerung leben in Städten. Hauptsiedlungsgebiete sind das Küstentiefland und die Cordillera de Mérida, während in der südlichen Landeshälfte nur 4 Prozent der Bevölkerung leben. 3.1 Wichtige Städte Caracas, Hauptstadt und wirtschaftliches Zentrum des Landes, hat 2,09 Millionen Einwohner (2007). Die nahe gelegene Stadt La Guaria ist der Seehafen von Caracas. Zweitgrößte Stadt ist Maracaibo (1,45 Millionen) am Maracaibosee, ein Zentrum der Erdölindustrie. Valencia (840 000) ist eines der wichtigsten Industriezentren des Landes. Barquisimeto (1 085 000) liegt an der Kreuzung mehrerer wichtiger Straßenverbindungen und ist ein bedeutender Bahnknotenpunkt. 3.2 Sprache und Religion Amtssprache in Venezuela ist Spanisch, regional sind auch indianische Sprachen verbreitet wie Goajiro, Guaraúno, Cariña und Pemón. 96 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum Katholizismus; Protestanten, Orthodoxe, Muslime, Juden und Anhänger von indigenen Religionen bilden Minderheiten. Die gesetzlichen Feiertage Venezuelas sind Neujahr (1. Januar), Carnaval (zwei Tage vor Aschermittwoch), Aschermittwoch, Ostern (mit Gründonnerstag und Karfreitag), der Tag der Unabhängigkeitserklärung (19. April), der 1. Mai, die Schlacht bei Carabobo (24. Juni), der Unabhängigkeitstag (5. Juli), der Geburtstag Simón Bolívars (24. Juli), der Tag der öffentlichen Angestellten (erster Montag im September), der Kolumbustag (12. Oktober), Heiligabend, der 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) und Silvester. An jedem Feiertag werden die Statuen des venezolanischen Nationalhelden Simón Bolívar mit farbenfrohen Kränzen geschmückt. 3.3 Soziales Die Gesellschaft Venezuelas ist von erheblichen sozialen Gegensätzen geprägt. 31,3 Prozent der Landesbewohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Der Staat unterstützt in begrenztem Umfang eine Gesundheits-, Unfall- und Rentenversicherung. Die Lebenserwartung liegt bei 73,5 Jahren (2008). Aufgrund der Armut und der hohen Arbeitslosigkeit suchen viele Menschen aus ländlichen Gebieten nach besseren Lebensbedingungen in den Städten, wo sich in den Außenbezirken Slumsiedlungen (Barrios) mit unzureichenden hygienischen Bedingungen bilden. 4 BILDUNG UND KULTUR Von der Kultur der indianischen Urbevölkerung sind nur noch wenige Zeugnisse sichtbar; einerseits wurde sie von den spanischen Eroberern weitgehend überprägt, andererseits ist vieles noch nicht erforscht. Es bestand ein markanter Gegensatz zwischen den Ethnien, die im Orinoco-Tiefland lebten, und den Hochlandbewohnern im Nordwesten. Die heutige Kultur Venezuelas wird durch drei Einflusssphären bestimmt, durch die indigene Bevölkerung (Indianer aus der Gruppe der Arawaks und der Kariben), die spanischstämmige Bevölkerung sowie die Schwarzen, Nachfahren der aus Westafrika eingeschleppten Sklaven. Einen besonderen Mythos verkörpert der Llanero, der südamerikanische Cowboy. Mit ihm verbunden sind der Nationaltanz, der Joropo, und solch verbreitete Instrumente wie Maraco, eine kleine Harfe, und Cuarto, eine kleine Gitarre. 4.1 Bildung und Schulwesen Der Schulbesuch in Venezuela ist kostenfrei, es besteht eine Schulpflicht von 10 Jahren. Der Alphabetisierungsgrad liegt bei 94 Prozent (2005). Auf den sechs Jahre dauernden Besuch der Primarschule folgt eine vierjährige Sekundarstufe, die durch verschiedene Einrichtungen repräsentiert sein kann. Die Absolvierung der Oberstufe wird mit dem Abitur abgeschlossen. Es gibt 20 Hochschuleinrichtungen, darunter die Zentrale Universität von Venezuela (gegründet 1721) und die Katholische Andrés-BelloUniversität (1953), beide in Caracas, die Andenuniversität (1785) in Mérida, die Zulia-Universität (1891) in Maracaibo und das Polytechnische Institut (1962) in Barquisimeto. 4.2 Kultureinrichtungen Einige der führenden Museen Venezuelas liegen in Caracas. Dazu gehören das Museum der Schönen Künste, das Museum für Kolonialkunst, das Naturkundemuseum und das Bolívarmuseum, das dem Leben und der Zeit Simón Bolívars gewidmet ist. Von Interesse sind auch das Talavera-Museum in Ciudad Bolívar und die historischen Museen in Maracaibo und Trujillo. 4.3 Kunst und Musik Venezuela war für die Spanier eine der weniger ergiebigen Kolonien, daher gibt es weniger spanische Architekturdenkmäler als in anderen südamerikanischen Ländern. Zudem wurden viele Bauten aus der Kolonialzeit durch Erdbeben zerstört. In der Altstadt von Coro sind viele Architekturdenkmäler erhalten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch hat sich durch die Einnahmen aus der Erdölförderung die moderne Architektur wesentlich entwickelt. Caracas gilt heute als eine der modernsten Städte Lateinamerikas, sie wurde baulich geprägt durch den renommierten Architekten Carlos Raúl Villanueva (1900-1975). Siehe lateinamerikanische Kunst und Architektur; lateinamerikanische Literatur; lateinamerikanische Musik. 5 VERWALTUNG UND POLITIK Venezuela ist nach der Verfassung von 1961 eine präsidiale Bundesrepublik. Am 1. Januar 2000 trat eine neue Verfassung in Kraft. Der Nationalfeiertag am 5. Juli erinnert an die Proklamierung der Unabhängigkeit im Jahr 1811. 5.1 Exekutive Staatsoberhaupt und Regierungschef ist der Präsident. Die neue Verfassung erweitert seine Machtbefugnisse erheblich. Er wird vom Volk für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt; eine direkte Wiederwahl ist möglich. Die alte Verfassung sah eine Amtszeit von fünf Jahren vor, eine unmittelbare Wiederwahl war nicht zulässig. Dem Präsidenten steht ein Ministerrat zur Seite. 5.2 Legislative Höchstes Legislativorgan ist das Einkammerparlament (Asamblea Nacional) mit 165 Sitzen. Die Mitglieder werden für eine Amtszeit von fünf Jahren vom Volk gewählt. Bis 1999 gab es ein Zweikammerparlament, das aus dem Abgeordnetenhaus (Cámara de Diputados) mit 189 Sitzen und dem Senat (Senado) mit 48 Mitgliedern bestand. Es besteht Wahlpflicht für Bürger ab 18 Jahren. 5.3 Judikative Die Justiz ist nach westeuropäischem Vorbild gestaltet. Höchste juristische Instanz in Venezuela ist der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo de Justicia). Seine 15 Richter werden vom Parlament auf neun Jahre gewählt. Jeder der Bundesstaaten hat ebenfalls einen Obersten Gerichtshof und mehrere nachgeordnete Gerichte. 5.4 Kommunalverwaltung Venezuela ist politisch in 22 Bundesstaaten (Estados) gegliedert, darunter zwei Bundesterritorien (Amazonas und Delta Amacuro) und den Bundesdistrikt, in dem die Hauptstadt Caracas liegt. Außerdem gibt es die aus den 72 Inseln im Karibischen Meer bestehenden Dependencias Federales. Jeder der Bundesstaaten Venezuelas sowie die Bundesterritorien und der Bundesdistrikt haben einen vom Staatspräsidenten ernannten Gouverneur und ein gewähltes Parlament. 5.5 Politische Parteien Zu den wichtigsten im Parlament vertretenen Parteien gehören der Movimiento V (Quinta) República (MVR, Bewegung Fünfte Republik), die Acción Democrática (AD, Demokratische Aktion) und der Partido Social-Cristiano (COPEI, Sozial-Christliche Partei). In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer drastischen Gewichtsverschiebung innerhalb der Parteienlandschaft. Die traditionell starken Parteien AD und COPEI, die mehr als vier Jahrzehnte tonangebend waren, mussten aufgrund von Misswirtschaft und Korruption starke Stimmeneinbußen hinnehmen. Zur dominierenden politischen Kraft wurde das von Hugo Chávez angeführte linksnationalistische Bündnis Polo Patriótico, bestehend aus der MVR, der Patria Para Todos (PPT) und weiteren kleineren Parteien. 5.6 Verteidigung Alle Männer in Venezuela im Alter zwischen 19 und 45 Jahren unterliegen der allgemeinen Wehrpflicht, die bei Heer und Luftwaffe 24 Monate und bei der Marine 30 Monate dauert. Die Stärke der Armee beträgt etwa 52 000 Soldaten (Heer 34 000, Marine 11 000, Luftwaffe 7 000). 6 WIRTSCHAFT Der Lebensstandard in Venezuela zählt zu den höchsten in Südamerika. Haupteinnahmequelle ist die Ausbeutung der reichen Erdölvorkommen; das Land ist Gründungsmitglied der OPEC. Die wirtschaftliche Potenz des Landes ist stark abhängig von den Erdölpreisen und unterliegt daher großen Schwankungen. Ein langfristiges Ziel der Regierung ist es, die industrielle Produktion auf eine breitere Basis zu stellen. 1993 setzte jedoch eine Wirtschaftskrise ein, die Inflation stieg vorübergehend auf bis zu 70 Prozent. Nach kurzzeitiger Verstärkung staatlicher Kontrollmaßnahmen erholte sich die Wirtschaft. 2006 betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 181 862 Millionen USDollar (Dienstleistungen 43,9 Prozent, Industrie 51,6 Prozent, Landwirtschaft 4,5 Prozent); daraus ergibt sich ein BIP pro Einwohner von 6 730,40 US-Dollar. 6.1 Landwirtschaft 11 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten in der Landwirtschaft. Wichtigste Anbauprodukte sind Mais, Zuckerrohr, Bananen, Ananas, Reis, Mohrenhirse, Maniok, Kaffee, Kakao und Zitrusfrüchte. Die Haltung von Vieh, insbesondere von Rindern, Schweinen und Ziegen, ist vorwiegend in den Llanos verbreitet. 6.2 Forstwirtschaft und Fischerei Obwohl die Wälder 52,3 Prozent des Landes bedecken, ist die forstliche Nutzung aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit weiter Gebiete wenig entwickelt. Nutzholz wird überwiegend als Brennstoff eingesetzt oder von der Bau-, Möbel- und Papierindustrie verwendet. Venezuela verfügt über einen großen Fischreichtum; die kommerziell wichtigsten Meerestiere sind Krabben und Thunfisch. Vor der Insel Margarita gibt es eine bedeutende Perlenfischerei. 6.3 Bergbau Erdölförderung im Becken um den Maracaibosee und im Ostteil des Landes beherrscht die Wirtschaft Venezuelas. Das Land zählt zu den führenden Erdölproduzenten der Welt. Die Reserven des Landes sind die größten auf dem amerikanischen Kontinent und laut Schätzungen die viertgrößten der Welt. Die ergiebigsten Ölfelder befinden sich im Becken des Maracaibosees. Ein Teil des Öls wird zur Verarbeitung in die Niederländischen Antillen exportiert. 1976 wurde die Erdölindustrie verstaatlicht, sie soll aber nach dem 1995 verkündeten Wirtschaftsprogramm auch wieder privaten Investitionen geöffnet werden. Das Land ist außerdem ein weltweit bedeutender Produzent von Erdgas. Ein weiteres Standbein für den Bergbau Venezuelas ist die Förderung von Eisenerz. Bereits in den vierziger Jahren wurden am Orinoco ausgedehnte Lagerstätten entdeckt. Das heutige Förderzentrum für Eisenerz liegt in Cerro Bolívar. Weitere kommerziell genutzte Bodenschätze sind Bauxit, Diamanten, Gold, Silber, Platin, Kohle, Salz, Kupfer, Zinn, Asbest, Phosphat, Titan und Glimmer. Die Insel Margarita vor der Nordküste hat bedeutende Magnesitreserven. Ende der achtziger Jahre wurden im Grenzgebiet zu Guyana ausgedehnte Goldvorkommen entdeckt. 6.4 Industrie Seit den sechziger Jahren verstärkte die venezolanische Regierung ihre Bemühungen um die Weiterentwicklung des produzierenden Gewerbes. Neben Caracas ist auch Ciudad Guayana ein bedeutendes Produktionszentrum. Wichtige Industriezweige Venezuelas sind neben Erdöl- und Erdgasförderung sowie Eisen- und Stahlproduktion die petrochemische Industrie, Aluminiumgewinnung, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie die Textilindustrie. Bedeutende Industriestandorte befinden sich beispielsweise bei Maracaibo, San Cristóbal, Caracas, Ciudad Guayana, Puerto La Cruz und Tucupita. 6.5 Währung und Bankwesen Die Währungseinheit Venezuelas ist der Bolívar (Bs) zu 100 Centímos. Die Zentralbank (Banco Central de Venezuela) wurde 1940 gegründet und fungiert als Staatsbank, Notenbank und Verrechnungsstelle der Geschäftsbanken. Die wichtigste Börse hat ihren Sitz in Caracas. Bei der Bankenkrise Anfang 1994 wurden zwölf der 47 in Venezuela tätigen Banken nach ihrer Zahlungsunfähigkeit unter staatliche Aufsicht gestellt. 6.6 Außenhandel Die wichtigsten Exportprodukte von Venezuela sind Erdöl und Erdgas. Daneben werden vor allem Metalle (z. B. Eisenerz) ausgeführt. Haupteinfuhrgüter sind neben Rohstoffen und Zwischenprodukten für die verarbeitende Industrie Maschinen und Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Konsumgüter. Wichtige Handelspartner sind vor allem die Vereinigten Staaten, gefolgt von Kolumbien, Japan, Ländern der Europäischen Union (z. B. Niederlande, Deutschland, Italien, Großbritannien), Mexiko und Brasilien. 6.7 Verkehrswesen Venezuela hat ein Straßennetz von 96 155 Kilometern Länge; etwa 34 Prozent der Straßen sind befestigt (1999). Das Schienennetz umfasst 682 Kilometer, die wichtigste Linie verbindet Puerto Cabello und Barquisimeto. Bedeutend ist auch der Verkehr auf den Wasserstraßen, besonders auf dem Orinoco. Am dichtesten ist das Verkehrsnetz im Norden, während die Verbindungen ins Landesinnere in einigen Gebieten noch unzulänglich sind. Das inländische Flugnetz ist gut ausgebaut; der wichtigste Flughafen liegt bei Caracas. Die internationale Fluglinie Venezolana Internacional de Aviación (Avisa) wurde 1991 privatisiert. 6.8 Energie 68,1 Prozent der in Venezuela erzeugten elektrischen Energie stammen aus Wasserkraftwerken. Eine der bedeutendsten Anlagen ist der Guristausee am Caroní; sie erzeugt nahezu die Hälfte des gesamten Strombedarfs. 7 GESCHICHTE 7.1 Vorgeschichte Archäologische Funde aus Muaco (Falcón) belegen, dass das Territorium des heutigen Venezuela um 15 000 v. Chr. besiedelt war. Im ersten vorchristlichen Jahrtausend gab es Ackerbau- und Keramikkulturen, die frühesten Keramikfunde datieren auf etwa 2500 v. Chr. 7.2 Kolonialzeit Auf seiner dritten Reise (1498-1500) entdeckte Christoph Kolumbus 1498 die Küstenregion zwischen Orinoco und der Insel Margarita, wo er an Land ging. Ein Jahr später folgte die Expedition von Alonso de Ojeda und Amerigo Vespucci, die dem Land wegen der Verbreitung von Pfahlbauten den Namen Venezuela (Klein-Venedig) gaben. In der Nähe von Cumaná entstand in den ersten Jahren nach 1500 die erste spanische Siedlung auf dem südamerikanischen Kontinent. Eine umfassendere Besiedlung durch die Spanier begann etwa ab 1520, die Stadt Coro ist eine Gründung aus dem Jahr 1527. Bis 1546 stand das Land unter der Verwaltung der Welser, eines Augsburger Handelshauses, das durch einen 1528 geschlossenen Kontrakt mit Kaiser Karl V. die weitere Kolonisierung des Territoriums übernahm und auf der Suche nach dem sagenhaften Goldland Eldorado weitere Expeditionen zur Erforschung und Ausbeutung des Landes finanzierte. Nachdem auf Befehl des spanischen Befehlshabers zwei Statthalter der Welser, Philipp von Hutten und Bartholomäus Welser, ermordet worden waren, endete 1546 die Welser-Hoheit über das Gebiet. In der Folgezeit gehörte Venezuela zur Audienca Santo Domingo (bis 1717), einem Bestandteil des Vizekönigreichs Neuspanien. Durch Erforschung des Orinoco wurde das bekannte Terrain weiter ausgedehnt. Die heutige Hauptstadt Caracas wurde 1567 gegründet und wenig später Sitz eines Gouverneurs. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam es zu Kämpfen mit der konkurrierenden Kolonialmacht England, in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts entstanden durch Siedlungsgründungen auch Konflikte mit niederländischen Kolonialisten, die 1634 die spanische Festung Curaçao einnahmen. 1717 wurde das Gebiet des heutigen Venezuela Teil des neu errichteten Vizekönigreiches Neugranada. 1783 wurde das Generalkapitanat Venezuela geschaffen, das ein etwa den heutigen Grenzen entsprechendes Territorium umfasste. Die Kultur der indigenen Bevölkerung wurde durch die rücksichtslose Kolonialisierung vielfach zerstört, die Einschleppung schwarzer Sklaven aus Westafrika, die ab dem 16. Jahrhundert ins Land kamen, veränderte die Bevölkerungsstruktur des Landes. 7.2.1 Unabhängigkeit Schon vor den Bemühungen der Freiheitskämpfer Simón Bolívar und Francisco de Miranda hatte es (1797 und 1806) Versuche gegeben, die Unabhängigkeit zu erringen. Aber erst die Revolution von 1810 führte zur Unabhängigkeitserklärung und Ausrufung der Republik am 5. Juli 1811, die jedoch nicht die sofortige Befreiung von Spanien brachte. Diese wurde erst durch mehrere Jahre andauernde Kämpfe errungen. 1819 bildete sich die Republik Groß-Kolumbien mit der Hauptstadt Bogotá. Die republikanischen Truppen errangen unter Führung von Bolívar bei Carabobo 1821 einen entscheidenden Sieg über die Armeen der spanischen Königstreuen. Als der Bund mit Neugranada (Kolumbien, Panamá) und Quito (Ecuador) zerbrach, und Groß-Kolumbien sich auflöste, wurde Venezuela 1830 ein selbständiger Staat. 7.2.2 Zeit der Diktaturen Die frühe Geschichte des unabhängigen Venezuela ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Revolutionen und Konterrevolutionen, die 1864 zur Umwandlung des Staates in die Estadios Unidos de Venezuela (Bundesrepublik Venezuela) führten. Eine privilegierte Oberklasse widersetzte sich der Durchführung liberaler Reformen, wie z. B. der Befreiung der Sklaven, die 1854 schließlich durchgesetzt wurde. Diese von Bürgerkriegen geprägte Phase gipfelte in der Diktatur von General Antonio Guzmán Blanco, die von 1870 bis 1888 andauerte. Auf Blancos Initiative wurde eine Reihe von Maßnahmen zur technologisch-wirtschaftlichen Modernisierung des Landes ergriffen, wie der Bau der Eisenbahn und die Einführung einer Nationalbank. Während der Herrschaft von General Cipriano Castro kam es 1902 zu Hafenblockaden durch Großbritannien, Frankreich, Deutschland und weiterer europäischer Mächte, weil die venezolanische Regierung ihre Schulden nicht bezahlt hatte. Zweimal wurden die Häfen von den Kriegsschiffen auch bombardiert. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschied 1904 zugunsten der Alliierten und verfügte, dass Venezuela bis Juli 1907 seine Schulden an die europäischen Mächte zurückzuzahlen habe. Im folgenden Jahr wurde Castro von General Juan Vicente Gómez abgesetzt. Er veränderte Castros Außenpolitik, die Venezuela in weitere Schwierigkeiten mit den europäischen Mächten und den Vereinigten Staaten gestürzt hatte. Im Inneren regierte er diktatorisch von 1908 bis zu seinem Tod 1935, von zwei Unterbrechungen (1915-1922 und 1929-1931) abgesehen. 1917 fand man in Venezuela Öl - ein für die Wirtschaft des Landes schnell bedeutend werdender Faktor. Mit Hilfe ausländischer Investoren wurden die reichen Erdölfelder ausgebeutet, mit den Exporterlösen entwickelte sich Venezuela zu einem der modernsten Staaten Südamerikas. Ein möglicher maßvoller Umbau von einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft wurde nicht initiiert. Die von Reformbestrebungen geprägte Regierung unter Präsident E. López Contreras (1935-1941) wurde durch das diktatorische Regime von General Isaías Medina Angarita (1941-1945) abgelöst. 7.2.3 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit Ende 1941 brach Venezuela die diplomatischen Beziehungen zu den Achsenmächten ab, aber erst im Februar 1945 erklärte es diesen den Krieg, um sich als Mitglied der Vereinten Nationen zu qualifizieren. 1945, nach dem Ende der Angarita-Diktatur, wurde Dr. Rómulo Betancourt von der sozialdemokratischen Acción Democrática (AD) Übergangspräsident. 1947 trat eine neue Verfassung in Kraft. Nach den kurz darauf durchgeführten ersten demokratischen Wahlen übernahm Rómulo Gallegos, Schriftsteller und Gründer der AD, die Präsidentschaft , die im Februar 1948 begann. Im November desselben Jahres wurde seine Regierung durch einen Militärputsch abgesetzt und die AD verboten. Die Militärs bildeten eine neue Regierung unter Oberstleutnant Carlos Delgado Chalbaud. Die Junta unterdrückte die Opposition, verbot alle Parteien und verhängte eine Pressezensur. Nach der Ermordung Delgado Chalbauds im November 1950 wurde der Diplomat Germán Suárez Flámerich Übergangspräsident. Suárez versprach, Wahlen für eine verfassunggebende Versammlung abzuhalten, die dann im November 1952 stattfanden. Die Unabhängige Wählerfront, von der Junta unterstützt, wurde zum Wahlsieger erklärt. Präsident wurde Oberst Marcos Pérez Jiménez, der Kandidat der Regierung. Die Oppositionsführer mussten ins Ausland flüchten. 7.2.4 Das Regime unter Pérez Jiménez Im April 1953 verabschiedete die Versammlung nach dreimonatigen Beratungen die Verfassung, die sofort in Kraft trat. Das Land, das seit 1864 den Namen Vereinigte Staaten von Venezuela trug, hieß jetzt Republik Venezuela. Die Regierung unterhielt gute Beziehungen zu den anderen Ländern des Kontinents; im März 1954 fand die 10. Internationale Konferenz der Amerikanischen Staaten in Caracas statt. Im Januar 1958 führte ein Generalstreik in Caracas zu einem Volksaufstand. Pérez Jiménez floh ins Ausland, und eine Gruppe von Militärs und Zivilisten, die so genannte Patriotische Junta unter Konteradmiral Wolfgang Larrazábal, übernahm die Regierung. 7.2.5 Demokratische Regierungen Bei den Wahlen im Dezember wurde der frühere Präsident Betancourt von der AD wieder gewählt. Er setzte im Januar 1961 eine neue Verfassung in Kraft. Trotz der Verfassungsbestimmungen, die die Gewerkschaftsfreiheit garantierten und gegen den Großgrundbesitz gerichtet waren, kam es 1961 wiederholt zu sozialen Unruhen und Aufständen. Während der Jahre 1962 und 1963 versuchten linksgerichtete Gruppen vergebens, die Regierung zu stürzen. Im Dezember 1963 wurde Raúl Leoni von der regierenden AD zum Präsidenten gewählt. Da er über keine Mehrheit im Parlament verfügte, bildete er eine Koalitionsregierung, und für die nächsten Jahre erlebte Venezuela eine Periode politischer Stabilität. 7.2.6 Verstaatlichung Im Dezember 1968 errang Rafael Caldera Rodriguez, der Führer der COPEI, einen knappen Wahlsieg gegen Leoni. Caldera trat sein Amt im März 1969 an. Damit war zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte Venezuelas die Macht friedlich an die Opposition abgetreten worden. Trotz seiner knappen Mehrheit regierte Caldera wirkungsvoll. Es gelang ihm, nahezu alle terroristischen Aktivitäten, von denen die späten sechziger Jahre gekennzeichnet waren, zu unterbinden. Wirtschaftlich verfolgte er eine Politik der Verstaatlichung der ausländischen Unternehmen. 1973 trat Venezuela dem fünf Jahre zuvor gegründeten Andenpakt bei, einer Vereinbarung über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador und Bolivien. Im Mai 1973 verabschiedete das Parlament einen Vertrag, der eine neuerliche Kandidatur des früheren Präsidenten Pérez Jiménez ausschloss. Bei den Wahlen im Dezember setzte sich Carlos Andrés Pérez Rodríguez, der Führer der AD, durch. Pérez verstaatlichte 1975 die Eisen- und Stahlindustrie, 1976 die Erdölindustrie. Die Wahlen 1978 wurden von der COPEI und ihrem Präsidentschaftskandidaten Luís Herrera Campíns gewonnen. Während seiner Amtszeit versuchte er, die Wirtschaft zu stabilisieren, da die Absatzmöglichkeiten für Erdölprodukte schwanden. Die Wahlen vom Dezember 1983 ergaben einen erdrutschartigen Sieg für die AD und ihren Kandidaten Jaime Lusinchi, der das Amt des Präsidenten übernahm. Auch die Wahlen von 1988 gewann die AD, und Carlos Andrés Pérez wurde zum zweiten Mal Präsident. Sein Sparprogramm führte im Februar 1989 zu Preissteigerungen, die blutige Unruhen in Caracas auslösten. Hastig aufgenommene Kredite bei den Vereinigten Staaten und anderen Ländern sowie erhöhte Exporterlöse aus dem Erdölsektor entspannten die Lage etwas. Dennoch hielt die Unzufriedenheit über die Regierungspolitik an. 1991 vereinbarten Venezuela, Kolumbien und Mexiko (die so genannten G-3), einen gemeinsamen Markt zu bilden, um Zollschranken abzubauen und eine Freihandelszone einzurichten. Der Vertrag trat am 1. Januar 1995 in Kraft. Im Februar und November 1992 wurden zwei Militärputsche niedergeschlagen. Der Februar-Putsch wurde von dem späteren Präsidenten Hugo Chávez durchgeführt, er wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Mai 1993 beschuldigte der Senat Pérez der Unterschlagung und des Missbrauchs von öffentlichen Geldern und enthob ihn einstimmig seines Amtes. Übergangspräsident wurde Senator Ramón José Velásquez. Im Dezember 1993 wurde Rafael Caldera Rodriguez ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt. Er versuchte, die Wirtschaftskrise mit einem Notstandsplan zu bekämpfen. Dazu führte er Preiskontrollen für Konsumgüter ein, ließ die Wechselkurse durch die Notenbank kontrollieren und verbot den freien Devisenhandel. Die Aufhebung einiger Grundrechte (u. a. das Recht auf persönliche Freiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung) wurde jedoch gegen seinen Willen zurückgenommen. Ein weiteres Wirtschaftsprogramm beinhaltete die Einführung einer Luxussteuer sowie die Privatisierung staatlicher Unternehmen. 7.3 Die Präsidentschaft von Hugo Chávez Im Dezember 1998 wurde der frühere Putschist Hugo Chávez mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Chávez hatte sich, nachdem er nach seinem Putschversuch zwei Jahre lang inhaftiert gewesen war, an die Spitze des linken Parteienbündnisses Polo Patriótico (PP) gesetzt, in dem Chávez' Partei Movimiento V (Quinta) República (MVR) die dominierende Kraft war. Nach seinem Amtsantritt im Februar 1999 kündigte Chávez einen revolutionären Kurs an, die so genannte ,,bolivarische Revolution", durch die auf friedlichem und demokratischem Wege die Armut und die sozialen Missstände beseitigt werden sollten. Durch ein Referendum erhielt Chávez im April 1999 die Zustimmung zur Erarbeitung einer neuen Verfassung, durch die das gesamte System neu gestaltet werden sollte. Die Verfassunggebende Versammlung (Asamblea Constituyente), die daraufhin gewählt wurde, bestand fast ausschließlich aus PP-Abgeordneten. Am 12. August 1999 rief die Constituyente per Dekret den Notstand aus und übertrug sich bzw. Chávez die Vollmacht, in die Arbeit sämtlicher staatlicher Organe einzugreifen und sie gegebenenfalls auch aufzulösen. Eine Woche später verhängte sie den Ausnahmezustand über das gesamte Justizwesen, und wenig später entmachtete sie schließlich auch das Parlament; im Ausland wurde dies als ,,schleichender Staatsstreich" interpretiert. Im Dezember 1999 nahm die Bevölkerung in einem Referendum die von der Verfassunggebenden Versammlung verabschiedete Verfassung an. Die neue Verfassung räumte dem Staatsoberhaupt größere Machtbefugnisse ein, verlängerte seine Amtszeit von fünf auf sechs Jahre, ermöglichte seine direkte Wiederwahl, unterstellte die Armee der alleinigen Kontrolle des Präsidenten und stattete ihn für den Fall des Ausnahmezustandes mit großen Vollmachten aus. Im Januar 2000 beschloss die Constituyente die Neuwahl des Präsidenten und anderer, regionaler Amtsträger und übergab ihre Befugnisse an ein ebenfalls von Chávez abhängiges Interimsparlament (,,Congressillo"), das über umfassende legislative und administrative Vollmachten verfügte. Aus den Präsidentschaftswahlen am 30. Juli 2000 ging Chávez mit fast 60 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. Bei den gleichzeitig abgehaltenen Parlamentswahlen gewann Chávez' PP 99 der insgesamt 165 Mandate (davon der MVR alleine 92), und auch die Gouverneurswahlen erbrachten eine Mehrheit für den PP. Im November 2000 verabschiedete das Parlament ein ,,Ermächtigungsgesetz", das es dem Präsidenten erlaubt, binnen eines Jahres in nahezu allen Bereichen eine unbeschränkte Anzahl von Gesetzen per Dekret zu erlassen. Von den Gesetzen, die Chávez nun dekretierte, stieß insbesondere das neue Bodenrecht, das im Grunde die Verfügungsgewalt über landwirtschaftlich nutzbaren Boden dem Staat übertrug, sowie weitere das Unternehmertum beschränkende und die Wirtschaft mit höheren Abgaben belastende Gesetze. Gewerkschaften reagierten ebenso mit Protesten und Massendemonstrationen wie Unternehmer und Grundbesitzer. Einen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung zwischen Chávez und weiten Teilen der venezolanischen Gesellschaft im Frühjahr 2002, nachdem Chávez die Führungsriege von Petróleos de Venezuela, des größten Erdölkonzerns des Landes, durch wenig qualifizierte, aber regierungstreue Manager ausgetauscht hatte. Diese zunehmende Politisierung der Wirtschaft, verbunden mit der anhaltenden tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise, für die Chávez verantwortlich gemacht wurde, veranlasste den Gewerkschaftsverband Confederación de Trabajadores (CTV) und den Unternehmerverband Fedecámeras sowie andere relevante gesellschaftliche Gruppierungen zu einem gemeinsamen Aktionsprogramm gegen den Präsidenten. Am 9. April 2002 riefen Gewerkschafts- und Unternehmerverband gemeinsam zu einem Streik auf, der sich bald zu einem unbefristeten Ausstand ausweitete und von Massenprotesten und immer lauter werdenden Rücktrittsforderungen gegenüber Chávez begleitet wurde. Am dritten Streiktag schlugen die Massenproteste in Unruhen um, bei denen in Folge eines massiven Polizeieinsatzes mehr als ein Dutzend Demonstranten getötet und Hunderte verletzt wurden. Nun traten auch Teile des Militärs auf die Seite der Gewerkschaften und Unternehmer über und zwangen Chávez am 12. April 2002 zum Rücktritt. Als Übergangspräsident wurde der Fedecámeras-Vorsitzende Pedro Carmona Estanga vereidigt. Carmona löste sogleich das Parlament und das Oberste Gericht auf, was national wie international auf scharfe Kritik stieß und die Meinung wieder zugunsten von Chávez umschlagen ließ. Neuerliche, teils gewaltsame Massenproteste, diesmal der Chávez-Anhänger, zwangen Carmona bereits am folgenden Tag wieder zum Rücktritt, und am 14. April 2002 kehrte Chávez mit Unterstützung loyaler Militärs ins Präsidentenamt zurück. Der von Chávez nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt angekündigte Dialog mit allen gesellschaftlich relevanten Gruppen fand nicht statt, und in der Folge kam es erneut zu Massenprotesten und Streiks. Anfang Dezember 2002 riefen Gewerkschafts- und Unternehmerverband einen weiteren Generalstreik aus, der bald auf unbefristete Zeit verlängert wurde. Zentrale Forderung der Streikenden war der Rücktritt des Präsidenten. Zunächst signalisierte die Regierung Verhandlungsbereitschaft, kehrte mit fortschreitender Dauer und Intensität des Generalstreiks jedoch zu ihrer Blockadehaltung zurück, während der Streik unterdessen die Ölwirtschaft, die wirtschaftliche Lebensader Venezuelas und neben dem Militär das wichtigste Machtinstrument Chávez', lahm legte und damit die gesamte Wirtschaft des Landes an den Rand des Ruins trieb. Unter dem Druck internationaler Vermittler beschloss die Opposition Anfang Februar 2003 die allmähliche Aufhebung des Streiks, der dem Staat bis dahin Verluste in Höhe von etwa 3,7 Milliarden Euro eingebracht und allein bei Petróleos de Venezuela 5 000 streikende Arbeiter den Job gekostet hatte. Wenige Wochen später unterzeichneten Regierung und Opposition ein Abkommen, in dem sich beide Seiten auf Mäßigung und Toleranz verpflichteten und Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung verurteilten. Zwei weiteren Abkommen vom April und Mai 2003, in denen die Regierung zur Überwindung der Dauerkrise einem Referendum über Chávez' Verbleib im Amt und den möglichen Konsequenzen zustimmte, verweigerte die Regierung am Ende doch die Unterschrift, was neuerliche Protestaktionen der Opposition nach sich zog. Im August 2003 reichte die Opposition etwa 2,7 Millionen Unterschriften bei der Wahlbehörde ein, mit denen sie ein Referendum über die Absetzung Chávez' herbeizuführen hoffte. Die Wahlbehörde lehnte die Unterschriften aus formalen Gründen ab. Im Oktober 2003 gab die Wahlbehörde schließlich doch einem Antrag auf Abhaltung eines Referendums statt. In der Folgezeit sammelte die Opposition weit mehr als die notwendigen etwa 2,5 Millionen Unterschriften und reichte sie bei der Wahlbehörde ein. Im März 2004 erklärte die Wahlbehörde den Antrag für abgelehnt, da angeblich nur etwa 1,9 der 3,4 Millionen abgegebenen Unterschriften gültig waren. Dies ließ die Vermutung zu, dass die in ihrer Mehrheit cháveztreue Wahlbehörde das Referendum zu verhindern, zumindest aber zu verzögern suchte. Es kam zu neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Anfang Juni 2004 konnten dann aufgrund einer Entscheidung der Wahlbehörde etwa 1,2 Millionen Venezolaner eine zweite Unterschrift leisten, um ihre vermeintlich ungültige Unterschrift aus der ersten Abstimmungsrunde zu bestätigen. Das Referendum über die Absetzung Chávez' fand am 15. August 2004 statt und bestätigte - entgegen den Erwartungen der Opposition - Chávez mit etwa 58 Prozent der Stimmen im Amt (bei einer Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent). Die Opposition erkannte das Wahlergebnis nicht an und warf der Regierung Wahlbetrug vor; internationale Wahlbeobachter, darunter Vertreter der Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) sowie Jimmy Carter, erklärten das Wahlergebnis für korrekt. In der Folgezeit setzte Chávez, gestärkt durch das Referendum und gestützt auf die wachsenden Einnahmen aus dem Erdölexport, seinen linkspopulistischen Kurs der ,,bolivarischen Revolution" mit Nachdruck und rücksichtslos fort. Im Inneren festigte Chávez seine Machtposition und die seines MVR weiter (u. a. befanden sich nun fast alle Gouverneursposten in Händen des MVR) und schaltete nach und nach führende Persönlichkeiten der Opposition aus; zudem forcierte er die Sozialprogramme, für die er auf die reichen Erlöse aus dem Erdölsektor zurückgreifen konnte und die seine Popularität bei den armen Bevölkerungsschichten festigten. In der Außenpolitik zeichnete er sich durch besondere Nähe zum sozialistischen Kuba aus, dem er u. a. zu günstigen Konditionen Erdöl zukommen ließ, sowie durch seine zunehmende Frontstellung gegenüber den USA. Die Parlamentswahlen am 4. Dezember 2005 gewann erwartungsgemäß Chávez' MVR. Die Partei errang 114 der insgesamt 165 Sitze, also mehr als zwei Drittel der Mandate; die übrigen Sitze gingen an verbündete Parteien. Die Opposition hatte die Wahlen boykottiert, die Wahlbeteiligung hatte nur etwa 25 Prozent betragen. Bei den Präsidentschaftswahlen am 3. Dezember 2006 wurde Chávez mit mehr als 62 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt; diesmal hatte die Opposition die Wahlen nicht boykottiert, die Wahlbeteiligung betrug knapp 75 Prozent. Um den von ihm bei seiner Vereidigung für die neue Amtszeit im Januar 2007 propagierten Aufbau eines ,,Sozialismus des 21. Jahrhunderts" möglichst rasch umsetzen zu können, ließ sich Chávez vom Parlament für 18 Monate das Recht übertragen, in verschiedenen Bereichen per Dekret, d. h. unabhängig von Parlament und Gesetzgebungsverfahren zu regieren; jedoch beherrschte Chávez unterdessen bereits alle staatlichen Institutionen einschließlich des Parlaments, so dass dieses ,,Ermächtigungsgesetz" einerseits überflüssig, andererseits als (verfassungsmäßiger) Schritt in die Diktatur erschien. Um den ,,Sozialismus des 21. Jahrhunderts" zu verankern und sich selbst die seiner Ansicht nach erforderliche Zeit zu verschaffen, seine ,,bolivarische Revolution" zu vollenden, legte Chávez im August 2007 eine in 69 Artikeln geänderte Verfassung vor, die vor allem den Präsidenten mit noch mehr Macht ausstattete und ihm unbeschränkt die Wiederwahl garantierte. Die von Kritikern als ,,Staatsstreich" bezeichnete geänderte Verfassung stellte Chávez im Dezember 2007 in einem Referendum zur Abstimmung; die Wähler lehnten die neue Verfassung jedoch mit knapper Mehrheit ab und brachten damit Chávez eine erste empfindliche Niederlage bei. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.