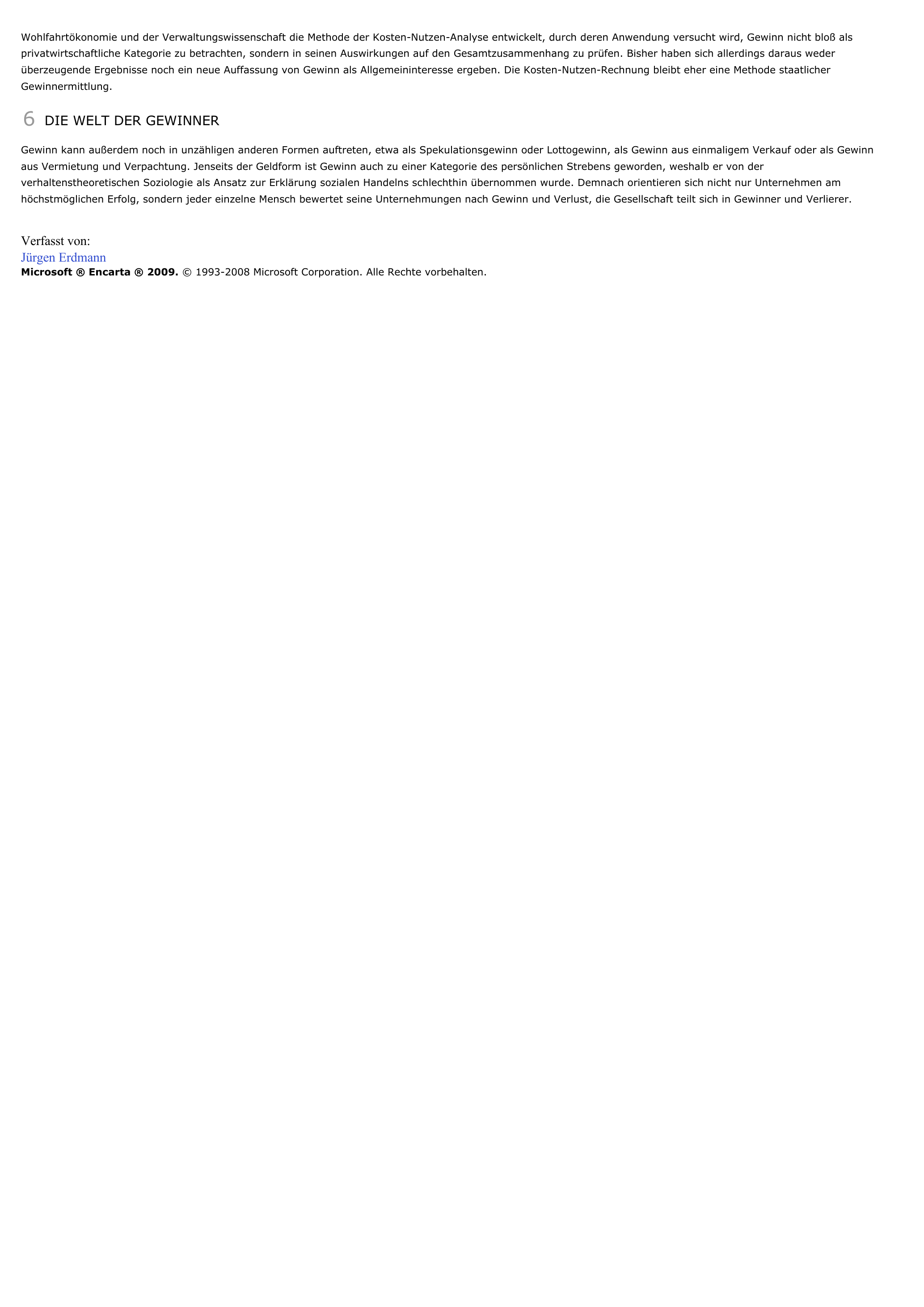Gewinn. 1 EINLEITUNG Gewinn, im allgemeinen Sinn der Überschuss des Ertrags über den Aufwand einer Unternehmung innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Gewinn gilt als zentrales Erfolgs- und Beurteilungskriterium der unternehmerischen Tätigkeit, aber auch des privaten Erfolgs. Das Gegenstück zum Gewinn ist der Verlust. 2 ALLGEMEINES Das Streben nach Gewinn bzw. Gewinnmaximierung gilt in der Wirtschaftstheorie als Grundantriebskraft für ökonomisches Verhalten. Es ergibt sich aus der Ungewissheit über die bestehenden Produktionsmethoden und Marktverhältnisse, somit aus der Tatsache, dass der Gewinn (oder der Verlust als negativer Gewinn) als schwankende Restgröße erst am Ende einer Wirtschaftsperiode festgestellt werden kann. Die wirtschaftliche Tätigkeit ist demgemäß immer auf den höchstmöglichen, nicht auf relativen oder ausreichenden Gewinn ausgerichtet. Darüber hinaus gelten der zeitliche Vorsprung und die Innovationsfähigkeit des kreativen Unternehmers (nach Joseph Alios Schumpeter), aber auch die Ausnutzung von Monopolstellungen als Entstehungsgründe des Gewinns. Nach der Marx'schen Analyse ist jeder Gewinn Monopolgewinn, da er der Abschöpfung des Mehrwerts durch die Besitzer der Produktionsmittel entspringt. Von der Grenznutzenschule geprägte Ansätze gehen hingegen von der Vorstellung eines ,,polypolistischen" Marktes aus, dessen Wechsellagen Differentialgewinne hervorbringen, die einmal diese, einmal jene Branche begünstigen, weshalb sie auch ,,windfall profits" genannt werden. Die Theorie des Gewinns scheint also eine eher windige Angelegenheit zu sein; im Handelsrecht ist seine Praxis hingegen klar geregelt. 3 DIE ARTEN DES GEWINNS NACH HANDELSRECHTLICHEN GRUNDSÄTZEN 3.1 1. Jahresüberschuss Der Jahresüberschuss ergibt sich als positive Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen des betreffenden Geschäftsjahres aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung. Gewinn- und Verlustvortrag, Entnahmen aus offenen Rücklagen und Einstellungen in offene Rücklagen werden dabei nicht berücksichtigt, weshalb der Jahresüberschuss ein genaues Bild über die Situation des Unternehmens gibt und bei Aktiengesellschaften als Ausgangsgrundlage für den Gewinnverwendungsvorschlag des Aufsichtsrates gilt. Ergibt sich eine negative Differenz, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag. 3.2 2. Bilanzgewinn Der Bilanzgewinn ist der Reingewinn einer Kapitalgesellschaft, wie er sich aus der Gegenüberstellung der Aktiv- und Passivposten der Bilanz ergibt. Er entspricht dem Rohgewinn abzüglich aller Kosten und Aufwendungen. Bilanztechnisch bildet man den Bilanzgewinn, indem der Jahresüberschuss um einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr oder um Entnahmen aus offenen Rücklagen erhöht oder um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und/oder um Einstellungen in die offenen Rücklagen vermindert wird. Der Bilanzgewinn gibt über den Erfolg einer Unternehmung nicht unbedingt hinreichend Auskunft, da z. B. bei einem Jahresfehlbetrag durch Entnahmen aus Rücklagen ein Gewinn gebildet werden kann. Dies ist vor allem für die Selbstdarstellung von Aktiengesellschaften relevant. Der Bilanzgewinn ist in der Jahresbilanz sowie in der Gewinn- und Verlust-Rechnung ungeteilt und gesondert auszuweisen. Die Verteilung des Gewinns einer Aktiengesellschaft beschließt die Hauptversammlung. Siehe auch Gesellschaftsformen (Wirtschaft) 3.3 3. Unternehmungsgewinn und Betriebsgewinn Der Betriebsgewinn gilt als das Ergebnis des betrieblichen Leistungsprozesses und wird aus der Gegenüberstellung der Kosten und Betriebserträge gebildet. Sein Gegenstück ist das neutrale Ergebnis, das sich z. B. aus betriebsfremden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträgen ergibt. Zusammen ergeben Betriebsgewinn und neutraler Gewinn den so genannten Unternehmungsgewinn (oder Verlust), der sich in der Gewinn- und Verlust-Rechnung wiederum in Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und außergewöhnliches Geschäftsergebnis teilt. Der Unternehmungsgewinn ist im Grunde identisch mit dem Jahresüberschuss. 3.4 4. Totalgewinn Der Totalerfolg ist die Differenz aus den gesamten Ein- und Auszahlungen während der Gesamtlebensdauer eines Unternehmens. Er wird durch eine Totalrechnung von der Gründung bis zur Liquidation ermittelt. Dem Totalgewinn kommt kaum praktische Bedeutung zu, er ist lediglich von historischem Interesse. 4 GEWINNERMITTLUNG Rein handelsrechtlich versteht man darunter die Ermittlung des Periodengewinns einer Unternehmung durch Gewinn- und Verlust-Rechnung, die in einer Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen und der Darstellung der Quellen des Betriebsergebnisses besteht. Siehe auch Privatrecht: Handelsrecht Die kurzfristige (z. B. monatliche) Erfolgsrechnung hat demgegenüber prinzipiell an Bedeutung verloren, da sich notwendige Zwischenergebnisse durch die Computerisierung der Buchhaltung einfach und ständig ermitteln lassen. Eine Sonderform stellt die Deckungsbeitragsrechnung dar, die auf einer Trennung von fixen und variablen Kosten in Bezug auf den Beschäftigungsgrad beruht. Sie ist ein wichtiges Instrument des Controlling, welches die Unternehmensführung mit entscheidungsrelevanten Informationen versorgen soll. Die steuerliche Gewinnermittlung wird für Zwecke der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbständiger Arbeit durchgeführt. Sie ist in den entsprechenden Gesetzestexten geregelt. Bei einer Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich gemäß § 4, 1 Einkommensteuergesetz (EStG) besteht der Gewinn in der Differenz des Vermögens am Ende und Anfang des abgelaufenen Wirtschaftsjahres, wobei Entnahmen zugezählt und Einlagen abgezogen werden. Der Wert des Grund und Bodens bleibt außer Ansatz. Diese Art der Gewinnermittlung gilt für alle buchführenden Land- und Forstwirte sowie selbständige Berufstätige. Der Betriebsvermögensvergleich nach § 5 EStG ist für Vollkaufleute und buchführende Gewerbetreibende vorgeschrieben. Diese Art der Gewinnermittlung erfolgt über eine Handelsbilanz, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsteht und aus der die Steuerbilanz abgeleitet wird. Für Freiberufler, Handwerker und Kleingewerbetreibende besteht nach § 4, 3 EStG die Möglichkeit einer vereinfachten Gewinnermittlung durch die Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. 5 NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE Um den gesellschaftlichen Nutzen (Gewinn) eines ökonomischen Projekts beurteilen zu können, haben Wissenschaftler aus den Fachbereichen der Wirtschaftstheorie, der Wohlfahrtökonomie und der Verwaltungswissenschaft die Methode der Kosten-Nutzen-Analyse entwickelt, durch deren Anwendung versucht wird, Gewinn nicht bloß als privatwirtschaftliche Kategorie zu betrachten, sondern in seinen Auswirkungen auf den Gesamtzusammenhang zu prüfen. Bisher haben sich allerdings daraus weder überzeugende Ergebnisse noch ein neue Auffassung von Gewinn als Allgemeininteresse ergeben. Die Kosten-Nutzen-Rechnung bleibt eher eine Methode staatlicher Gewinnermittlung. 6 DIE WELT DER GEWINNER Gewinn kann außerdem noch in unzähligen anderen Formen auftreten, etwa als Spekulationsgewinn oder Lottogewinn, als Gewinn aus einmaligem Verkauf oder als Gewinn aus Vermietung und Verpachtung. Jenseits der Geldform ist Gewinn auch zu einer Kategorie des persönlichen Strebens geworden, weshalb er von der verhaltenstheoretischen Soziologie als Ansatz zur Erklärung sozialen Handelns schlechthin übernommen wurde. Demnach orientieren sich nicht nur Unternehmen am höchstmöglichen Erfolg, sondern jeder einzelne Mensch bewertet seine Unternehmungen nach Gewinn und Verlust, die Gesellschaft teilt sich in Gewinner und Verlierer. Verfasst von: Jürgen Erdmann Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.