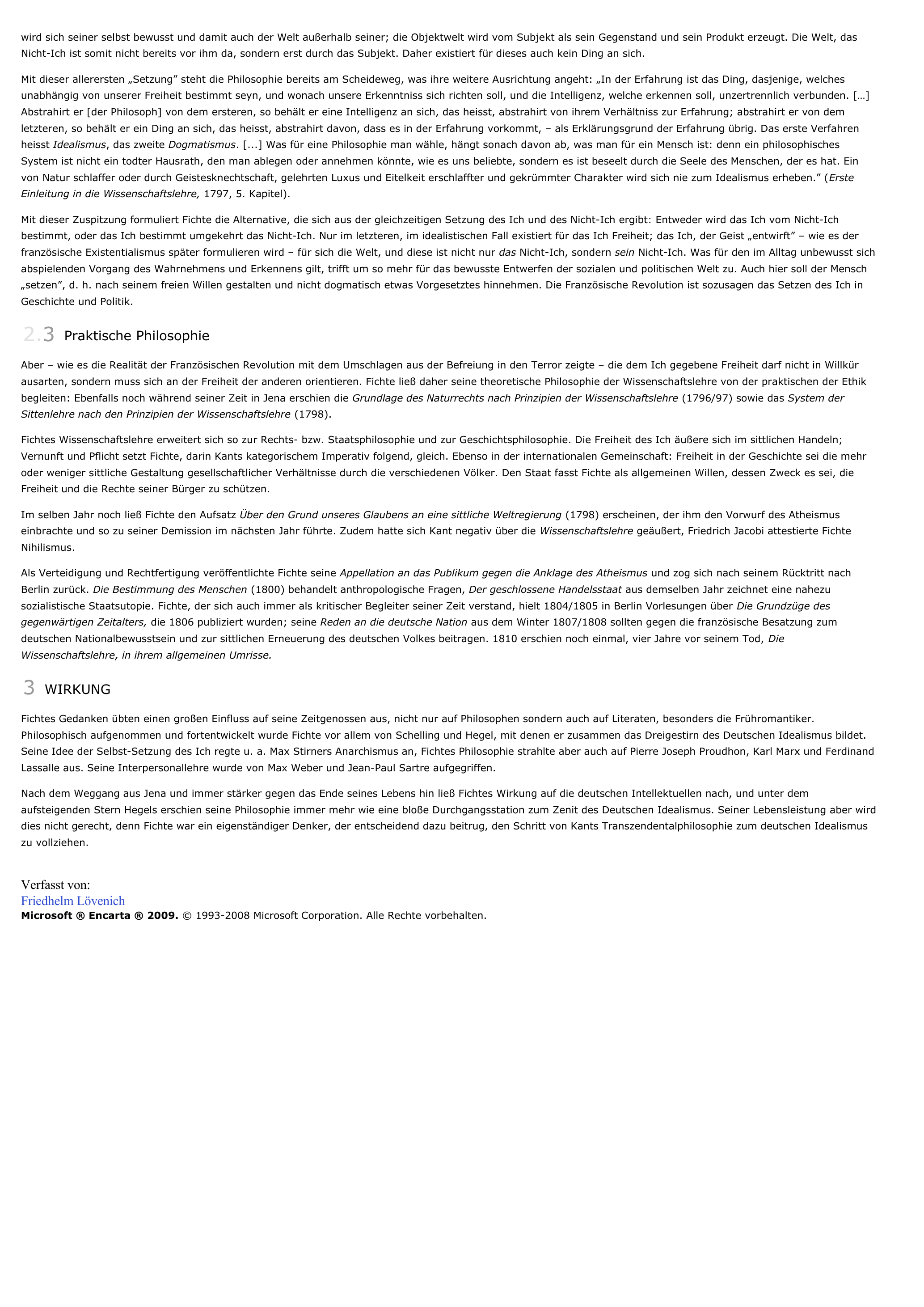Johann Gottlieb Fichte - Philosophie.
Publié le 17/06/2013

Extrait du document


«
wird sich seiner selbst bewusst und damit auch der Welt außerhalb seiner; die Objektwelt wird vom Subjekt als sein Gegenstand und sein Produkt erzeugt.
Die Welt, dasNicht-Ich ist somit nicht bereits vor ihm da, sondern erst durch das Subjekt.
Daher existiert für dieses auch kein Ding an sich.
Mit dieser allerersten „Setzung” steht die Philosophie bereits am Scheideweg, was ihre weitere Ausrichtung angeht: „In der Erfahrung ist das Ding, dasjenige, welchesunabhängig von unserer Freiheit bestimmt seyn, und wonach unsere Erkenntniss sich richten soll, und die Intelligenz, welche erkennen soll, unzertrennlich verbunden.
[…]Abstrahirt er [der Philosoph] von dem ersteren, so behält er eine Intelligenz an sich, das heisst, abstrahirt von ihrem Verhältniss zur Erfahrung; abstrahirt er von demletzteren, so behält er ein Ding an sich, das heisst, abstrahirt davon, dass es in der Erfahrung vorkommt, – als Erklärungsgrund der Erfahrung übrig.
Das erste Verfahrenheisst Idealismus , das zweite Dogmatismus .
[...] Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches System ist nicht ein todter Hausrath, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat.
Einvon Natur schlaffer oder durch Geistesknechtschaft, gelehrten Luxus und Eitelkeit erschlaffter und gekrümmter Charakter wird sich nie zum Idealismus erheben.” ( Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre, 1797, 5.
Kapitel).
Mit dieser Zuspitzung formuliert Fichte die Alternative, die sich aus der gleichzeitigen Setzung des Ich und des Nicht-Ich ergibt: Entweder wird das Ich vom Nicht-Ichbestimmt, oder das Ich bestimmt umgekehrt das Nicht-Ich.
Nur im letzteren, im idealistischen Fall existiert für das Ich Freiheit; das Ich, der Geist „entwirft” – wie es derfranzösische Existentialismus später formulieren wird – für sich die Welt, und diese ist nicht nur das Nicht-Ich, sondern sein Nicht-Ich.
Was für den im Alltag unbewusst sich abspielenden Vorgang des Wahrnehmens und Erkennens gilt, trifft um so mehr für das bewusste Entwerfen der sozialen und politischen Welt zu.
Auch hier soll der Mensch„setzen”, d.
h.
nach seinem freien Willen gestalten und nicht dogmatisch etwas Vorgesetztes hinnehmen.
Die Französische Revolution ist sozusagen das Setzen des Ich inGeschichte und Politik.
2.3 Praktische Philosophie
Aber – wie es die Realität der Französischen Revolution mit dem Umschlagen aus der Befreiung in den Terror zeigte – die dem Ich gegebene Freiheit darf nicht in Willkürausarten, sondern muss sich an der Freiheit der anderen orientieren.
Fichte ließ daher seine theoretische Philosophie der Wissenschaftslehre von der praktischen der Ethikbegleiten: Ebenfalls noch während seiner Zeit in Jena erschien die Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1796/97) sowie das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798).
Fichtes Wissenschaftslehre erweitert sich so zur Rechts- bzw.
Staatsphilosophie und zur Geschichtsphilosophie.
Die Freiheit des Ich äußere sich im sittlichen Handeln;Vernunft und Pflicht setzt Fichte, darin Kants kategorischem Imperativ folgend, gleich.
Ebenso in der internationalen Gemeinschaft: Freiheit in der Geschichte sei die mehroder weniger sittliche Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse durch die verschiedenen Völker.
Den Staat fasst Fichte als allgemeinen Willen, dessen Zweck es sei, dieFreiheit und die Rechte seiner Bürger zu schützen.
Im selben Jahr noch ließ Fichte den Aufsatz Über den Grund unseres Glaubens an eine sittliche Weltregierung (1798) erscheinen, der ihm den Vorwurf des Atheismus einbrachte und so zu seiner Demission im nächsten Jahr führte.
Zudem hatte sich Kant negativ über die Wissenschaftslehre geäußert, Friedrich Jacobi attestierte Fichte Nihilismus.
Als Verteidigung und Rechtfertigung veröffentlichte Fichte seine Appellation an das Publikum gegen die Anklage des Atheismus und zog sich nach seinem Rücktritt nach Berlin zurück.
Die Bestimmung des Menschen (1800) behandelt anthropologische Fragen, Der geschlossene Handelsstaat aus demselben Jahr zeichnet eine nahezu sozialistische Staatsutopie.
Fichte, der sich auch immer als kritischer Begleiter seiner Zeit verstand, hielt 1804/1805 in Berlin Vorlesungen über Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, die 1806 publiziert wurden; seine Reden an die deutsche Nation aus dem Winter 1807/1808 sollten gegen die französische Besatzung zum deutschen Nationalbewusstsein und zur sittlichen Erneuerung des deutschen Volkes beitragen.
1810 erschien noch einmal, vier Jahre vor seinem Tod, Die Wissenschaftslehre, in ihrem allgemeinen Umrisse.
3 WIRKUNG
Fichtes Gedanken übten einen großen Einfluss auf seine Zeitgenossen aus, nicht nur auf Philosophen sondern auch auf Literaten, besonders die Frühromantiker.Philosophisch aufgenommen und fortentwickelt wurde Fichte vor allem von Schelling und Hegel, mit denen er zusammen das Dreigestirn des Deutschen Idealismus bildet.Seine Idee der Selbst-Setzung des Ich regte u.
a.
Max Stirners Anarchismus an, Fichtes Philosophie strahlte aber auch auf Pierre Joseph Proudhon, Karl Marx und FerdinandLassalle aus.
Seine Interpersonallehre wurde von Max Weber und Jean-Paul Sartre aufgegriffen.
Nach dem Weggang aus Jena und immer stärker gegen das Ende seines Lebens hin ließ Fichtes Wirkung auf die deutschen Intellektuellen nach, und unter demaufsteigenden Stern Hegels erschien seine Philosophie immer mehr wie eine bloße Durchgangsstation zum Zenit des Deutschen Idealismus.
Seiner Lebensleistung aber wirddies nicht gerecht, denn Fichte war ein eigenständiger Denker, der entscheidend dazu beitrug, den Schritt von Kants Transzendentalphilosophie zum deutschen Idealismuszu vollziehen.
Verfasst von:Friedhelm LövenichMicrosoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Alle Rechte vorbehalten..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fichte, Johann Gottlieb - philosophie.
- THÉORIE DE LA SCIENCE (LA) ou DOCTRINE DE LA SCIENCE, Johann Gottlieb Fichte (résumé & analyse)
- SYSTÈME DE L’ÉTHIQUE D’APRÈS LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE DE LA SCIENCE, Johann Gottlieb Fichte
- FONDEMENT DU DROIT NATUREL SELON LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE DE LA SCIENCE, Johann Gottlieb Fichte
- INITIATION À LA VIE BIENHEUREUSE, Johann Gottlieb Fichte - étude de l'œuvre