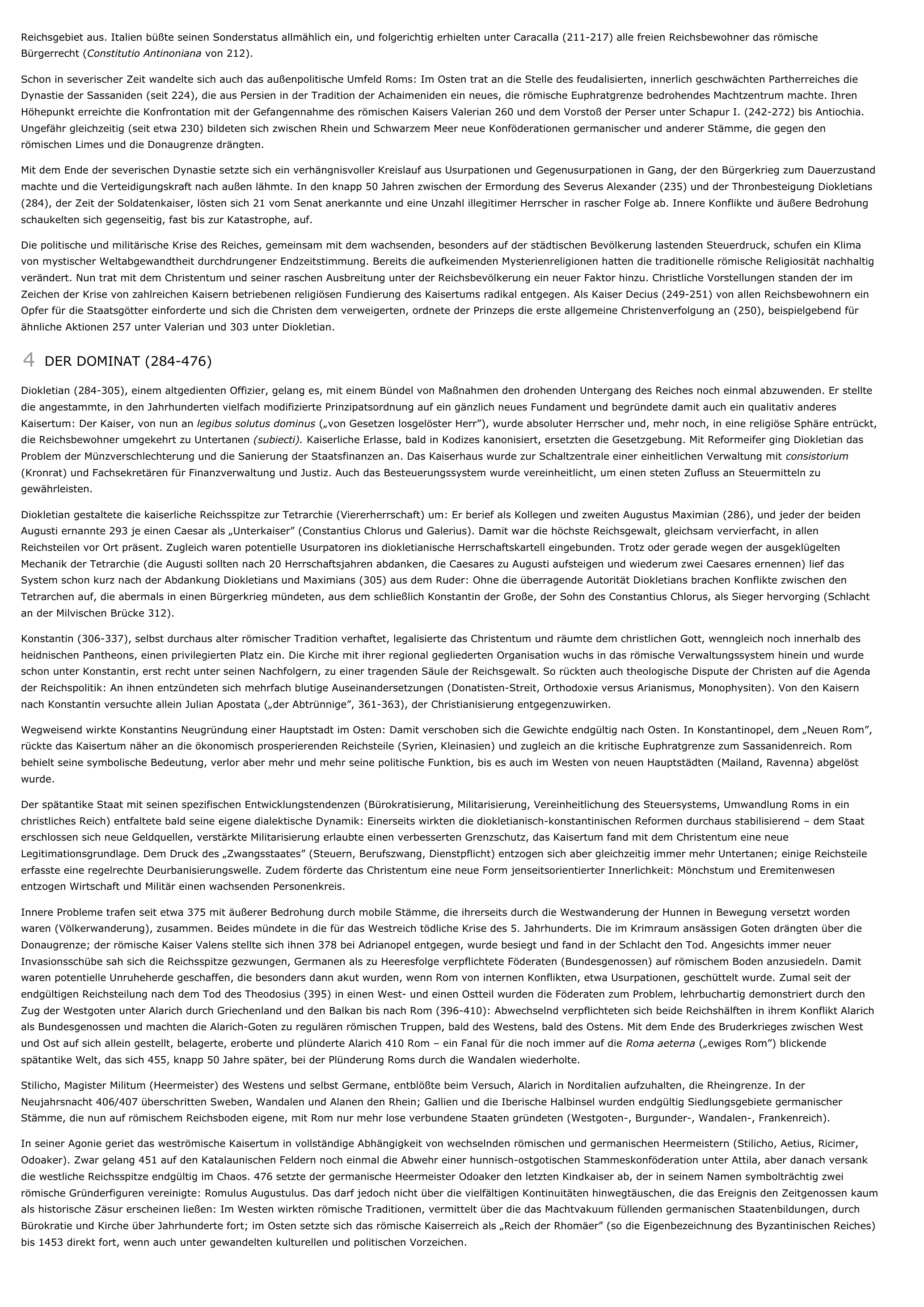Römisches Kaiserreich - Geschichte.
Publié le 13/06/2013

Extrait du document
«
Reichsgebiet aus.
Italien büßte seinen Sonderstatus allmählich ein, und folgerichtig erhielten unter Caracalla (211-217) alle freien Reichsbewohner das römischeBürgerrecht ( Constitutio Antinoniana von 212).
Schon in severischer Zeit wandelte sich auch das außenpolitische Umfeld Roms: Im Osten trat an die Stelle des feudalisierten, innerlich geschwächten Partherreiches dieDynastie der Sassaniden (seit 224), die aus Persien in der Tradition der Achaimeniden ein neues, die römische Euphratgrenze bedrohendes Machtzentrum machte.
IhrenHöhepunkt erreichte die Konfrontation mit der Gefangennahme des römischen Kaisers Valerian 260 und dem Vorstoß der Perser unter Schapur I.
(242-272) bis Antiochia.Ungefähr gleichzeitig (seit etwa 230) bildeten sich zwischen Rhein und Schwarzem Meer neue Konföderationen germanischer und anderer Stämme, die gegen denrömischen Limes und die Donaugrenze drängten.
Mit dem Ende der severischen Dynastie setzte sich ein verhängnisvoller Kreislauf aus Usurpationen und Gegenusurpationen in Gang, der den Bürgerkrieg zum Dauerzustandmachte und die Verteidigungskraft nach außen lähmte.
In den knapp 50 Jahren zwischen der Ermordung des Severus Alexander (235) und der Thronbesteigung Diokletians(284), der Zeit der Soldatenkaiser, lösten sich 21 vom Senat anerkannte und eine Unzahl illegitimer Herrscher in rascher Folge ab.
Innere Konflikte und äußere Bedrohungschaukelten sich gegenseitig, fast bis zur Katastrophe, auf.
Die politische und militärische Krise des Reiches, gemeinsam mit dem wachsenden, besonders auf der städtischen Bevölkerung lastenden Steuerdruck, schufen ein Klimavon mystischer Weltabgewandtheit durchdrungener Endzeitstimmung.
Bereits die aufkeimenden Mysterienreligionen hatten die traditionelle römische Religiosität nachhaltigverändert.
Nun trat mit dem Christentum und seiner raschen Ausbreitung unter der Reichsbevölkerung ein neuer Faktor hinzu.
Christliche Vorstellungen standen der imZeichen der Krise von zahlreichen Kaisern betriebenen religiösen Fundierung des Kaisertums radikal entgegen.
Als Kaiser Decius (249-251) von allen Reichsbewohnern einOpfer für die Staatsgötter einforderte und sich die Christen dem verweigerten, ordnete der Prinzeps die erste allgemeine Christenverfolgung an (250), beispielgebend fürähnliche Aktionen 257 unter Valerian und 303 unter Diokletian.
4 DER DOMINAT (284-476)
Diokletian (284-305), einem altgedienten Offizier, gelang es, mit einem Bündel von Maßnahmen den drohenden Untergang des Reiches noch einmal abzuwenden.
Er stelltedie angestammte, in den Jahrhunderten vielfach modifizierte Prinzipatsordnung auf ein gänzlich neues Fundament und begründete damit auch ein qualitativ anderesKaisertum: Der Kaiser, von nun an legibus solutus dominus („von Gesetzen losgelöster Herr”), wurde absoluter Herrscher und, mehr noch, in eine religiöse Sphäre entrückt, die Reichsbewohner umgekehrt zu Untertanen (subiecti). Kaiserliche Erlasse, bald in Kodizes kanonisiert, ersetzten die Gesetzgebung.
Mit Reformeifer ging Diokletian das Problem der Münzverschlechterung und die Sanierung der Staatsfinanzen an.
Das Kaiserhaus wurde zur Schaltzentrale einer einheitlichen Verwaltung mit consistorium (Kronrat) und Fachsekretären für Finanzverwaltung und Justiz.
Auch das Besteuerungssystem wurde vereinheitlicht, um einen steten Zufluss an Steuermitteln zugewährleisten.
Diokletian gestaltete die kaiserliche Reichsspitze zur Tetrarchie (Viererherrschaft) um: Er berief als Kollegen und zweiten Augustus Maximian (286), und jeder der beidenAugusti ernannte 293 je einen Caesar als „Unterkaiser” (Constantius Chlorus und Galerius).
Damit war die höchste Reichsgewalt, gleichsam vervierfacht, in allenReichsteilen vor Ort präsent.
Zugleich waren potentielle Usurpatoren ins diokletianische Herrschaftskartell eingebunden.
Trotz oder gerade wegen der ausgeklügeltenMechanik der Tetrarchie (die Augusti sollten nach 20 Herrschaftsjahren abdanken, die Caesares zu Augusti aufsteigen und wiederum zwei Caesares ernennen) lief dasSystem schon kurz nach der Abdankung Diokletians und Maximians (305) aus dem Ruder: Ohne die überragende Autorität Diokletians brachen Konflikte zwischen denTetrarchen auf, die abermals in einen Bürgerkrieg mündeten, aus dem schließlich Konstantin der Große, der Sohn des Constantius Chlorus, als Sieger hervorging (Schlachtan der Milvischen Brücke 312).
Konstantin (306-337), selbst durchaus alter römischer Tradition verhaftet, legalisierte das Christentum und räumte dem christlichen Gott, wenngleich noch innerhalb desheidnischen Pantheons, einen privilegierten Platz ein.
Die Kirche mit ihrer regional gegliederten Organisation wuchs in das römische Verwaltungssystem hinein und wurdeschon unter Konstantin, erst recht unter seinen Nachfolgern, zu einer tragenden Säule der Reichsgewalt.
So rückten auch theologische Dispute der Christen auf die Agendader Reichspolitik: An ihnen entzündeten sich mehrfach blutige Auseinandersetzungen (Donatisten-Streit, Orthodoxie versus Arianismus, Monophysiten).
Von den Kaisernnach Konstantin versuchte allein Julian Apostata („der Abtrünnige”, 361-363), der Christianisierung entgegenzuwirken.
Wegweisend wirkte Konstantins Neugründung einer Hauptstadt im Osten: Damit verschoben sich die Gewichte endgültig nach Osten.
In Konstantinopel, dem „Neuen Rom”,rückte das Kaisertum näher an die ökonomisch prosperierenden Reichsteile (Syrien, Kleinasien) und zugleich an die kritische Euphratgrenze zum Sassanidenreich.
Rombehielt seine symbolische Bedeutung, verlor aber mehr und mehr seine politische Funktion, bis es auch im Westen von neuen Hauptstädten (Mailand, Ravenna) abgelöstwurde.
Der spätantike Staat mit seinen spezifischen Entwicklungstendenzen (Bürokratisierung, Militarisierung, Vereinheitlichung des Steuersystems, Umwandlung Roms in einchristliches Reich) entfaltete bald seine eigene dialektische Dynamik: Einerseits wirkten die diokletianisch-konstantinischen Reformen durchaus stabilisierend – dem Staaterschlossen sich neue Geldquellen, verstärkte Militarisierung erlaubte einen verbesserten Grenzschutz, das Kaisertum fand mit dem Christentum eine neueLegitimationsgrundlage.
Dem Druck des „Zwangsstaates” (Steuern, Berufszwang, Dienstpflicht) entzogen sich aber gleichzeitig immer mehr Untertanen; einige Reichsteileerfasste eine regelrechte Deurbanisierungswelle.
Zudem förderte das Christentum eine neue Form jenseitsorientierter Innerlichkeit: Mönchstum und Eremitenwesenentzogen Wirtschaft und Militär einen wachsenden Personenkreis.
Innere Probleme trafen seit etwa 375 mit äußerer Bedrohung durch mobile Stämme, die ihrerseits durch die Westwanderung der Hunnen in Bewegung versetzt wordenwaren (Völkerwanderung), zusammen.
Beides mündete in die für das Westreich tödliche Krise des 5.
Jahrhunderts.
Die im Krimraum ansässigen Goten drängten über dieDonaugrenze; der römische Kaiser Valens stellte sich ihnen 378 bei Adrianopel entgegen, wurde besiegt und fand in der Schlacht den Tod.
Angesichts immer neuerInvasionsschübe sah sich die Reichsspitze gezwungen, Germanen als zu Heeresfolge verpflichtete Föderaten (Bundesgenossen) auf römischem Boden anzusiedeln.
Damitwaren potentielle Unruheherde geschaffen, die besonders dann akut wurden, wenn Rom von internen Konflikten, etwa Usurpationen, geschüttelt wurde.
Zumal seit derendgültigen Reichsteilung nach dem Tod des Theodosius (395) in einen West- und einen Ostteil wurden die Föderaten zum Problem, lehrbuchartig demonstriert durch denZug der Westgoten unter Alarich durch Griechenland und den Balkan bis nach Rom (396-410): Abwechselnd verpflichteten sich beide Reichshälften in ihrem Konflikt Alarichals Bundesgenossen und machten die Alarich-Goten zu regulären römischen Truppen, bald des Westens, bald des Ostens.
Mit dem Ende des Bruderkrieges zwischen Westund Ost auf sich allein gestellt, belagerte, eroberte und plünderte Alarich 410 Rom – ein Fanal für die noch immer auf die Roma aeterna („ewiges Rom”) blickende spätantike Welt, das sich 455, knapp 50 Jahre später, bei der Plünderung Roms durch die Wandalen wiederholte.
Stilicho, Magister Militum (Heermeister) des Westens und selbst Germane, entblößte beim Versuch, Alarich in Norditalien aufzuhalten, die Rheingrenze.
In der Neujahrsnacht 406/407 überschritten Sweben, Wandalen und Alanen den Rhein; Gallien und die Iberische Halbinsel wurden endgültig Siedlungsgebiete germanischerStämme, die nun auf römischem Reichsboden eigene, mit Rom nur mehr lose verbundene Staaten gründeten (Westgoten-, Burgunder-, Wandalen-, Frankenreich).
In seiner Agonie geriet das weströmische Kaisertum in vollständige Abhängigkeit von wechselnden römischen und germanischen Heermeistern (Stilicho, Aetius, Ricimer,Odoaker).
Zwar gelang 451 auf den Katalaunischen Feldern noch einmal die Abwehr einer hunnisch-ostgotischen Stammeskonföderation unter Attila, aber danach versankdie westliche Reichsspitze endgültig im Chaos.
476 setzte der germanische Heermeister Odoaker den letzten Kindkaiser ab, der in seinem Namen symbolträchtig zweirömische Gründerfiguren vereinigte: Romulus Augustulus.
Das darf jedoch nicht über die vielfältigen Kontinuitäten hinwegtäuschen, die das Ereignis den Zeitgenossen kaumals historische Zäsur erscheinen ließen: Im Westen wirkten römische Traditionen, vermittelt über die das Machtvakuum füllenden germanischen Staatenbildungen, durchBürokratie und Kirche über Jahrhunderte fort; im Osten setzte sich das römische Kaiserreich als „Reich der Rhomäer” (so die Eigenbezeichnung des Byzantinischen Reiches)bis 1453 direkt fort, wenn auch unter gewandelten kulturellen und politischen Vorzeichen..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Römisches Kaiserreich - Geschichte.
- Deutsches Kaiserreich - Geschichte.
- Heiliges Römisches Reich - Geschichte.
- ORIGINE ET SENS DE L’HISTOIRE [Ursprung und Sinn der Geschichte] de Karl Jaspers (Résumé et analyse)
- Rudolf Eucken: Einführung in die Geschichte der Philosophie Anthologie.