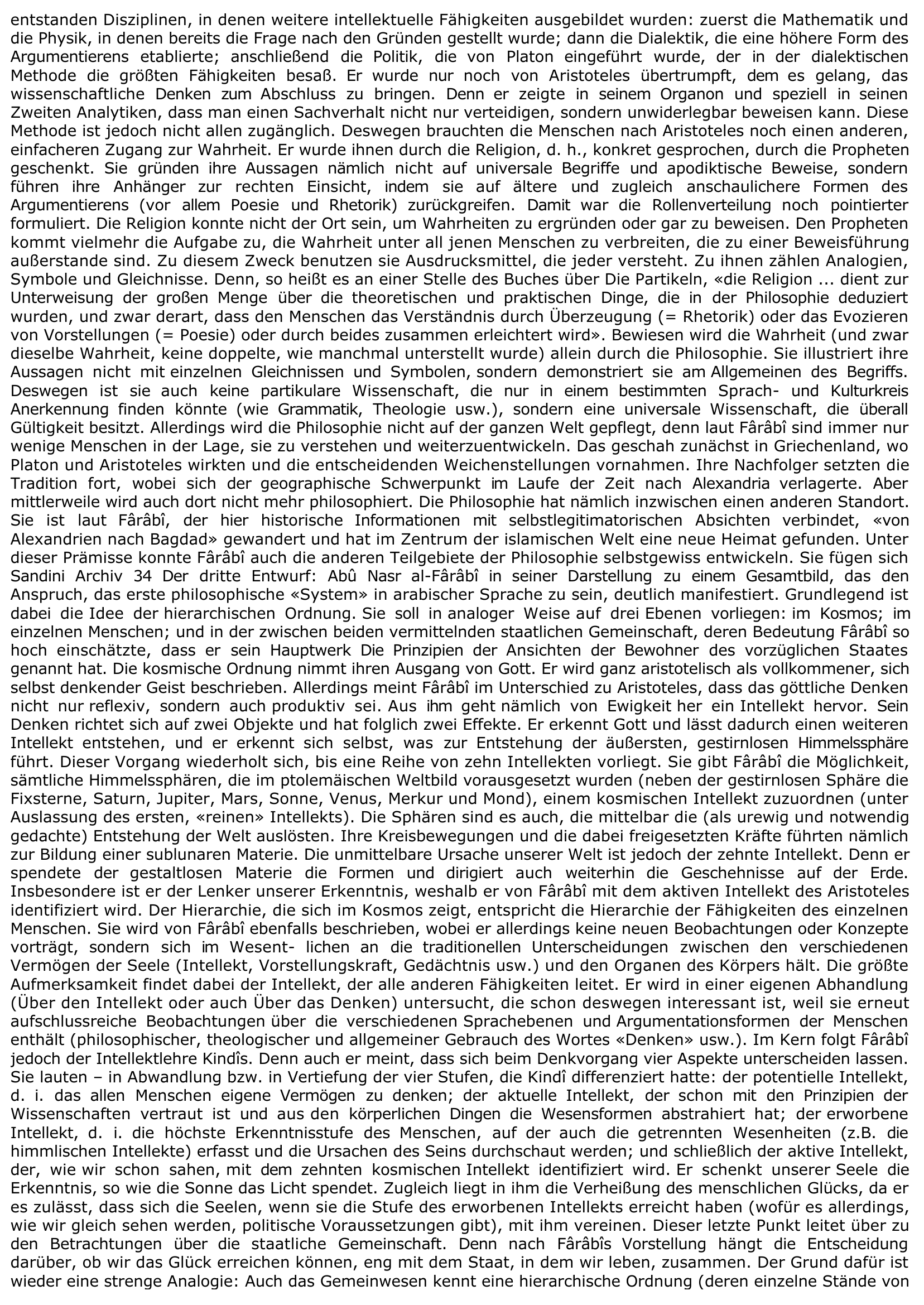Der dritte Entwurf: Abû Nasr al-Fârâbî
Publié le 06/01/2010

Extrait du document
Râzîs Programm war kühn und eröffnete der Philosophie neue Perspektiven. War ihr von Kindî noch eine dienende Funktion gegenüber dem Dogma zugewiesen worden, so hieß es jetzt in Umkehrung dieser Einschätzung, sie übertreffe jedes religiös inspirierte Denken und sei der einzige Weg, die Wahrheit zu erkennen. Beide Entwürfe hatten indessen eines gemeinsam. Ihnen fehlte jeweils eine methodisch überzeugende Begründung für ihre weitreichenden Feststellungen. Denn weder Kindî noch Râzî hatten ein umfassendes hermeneutisches Konzept vorgelegt, aus dem hervorging, was das Spezifikum der philosophischen Erkenntnis eigentlich sei und in welcher Relation sie zu den anderen Formen des Denkens und Verstehens (Offenbarung, Theologie, Rechtswissenschaft usw.), die ebenfalls einen Wahrheitsanspruch erhoben, stehen sollte. Solche Grundfragen erörterte erst Abû Nasr al-Fârâbî (ca. 870-950). Er ging wie Râzî von der Überlegenheit der Philosophie aus, fand aber Wege, diese Annahme nicht nur zu postulieren, sondern durch eine eingehende Reflexion über die verschiedenen menschlichen Erkenntnismöglichkeiten zu begründen. Auch Fârâbîs Wirken fiel noch in die Zeit, in der antike Werke ins Arabische übersetzt wurden. Er selbst nahm an diesem Prozess sogar teil, denn er verbrachte viele Jahre in einem Kreis von Bagdader Intellektuellen (vorwiegend Christen wie Yühannä ibn Hailän und Abû Bischr Mattâ), die philosophische Texte (jetzt in der Regel aus dem Syrischen) übersetzten und eingehend diskutierten. Gleichwohl war seine Stellung gegenüber dem antiken Erbe nicht mehr vergleichbar mit den Positionen seiner Vorgänger. Denn diese hatten, wie wir sahen, jeweils nur bestimmte Ausschnitte aus der breiten Überlieferung kennen gelernt (Kindî vor allem einzelne aristotelische und neuplatonische Werke, Râzî in erster Linie die Platonlektüre der Mediziner).
«
entstanden Disziplinen, in denen weitere intellektuelle Fähigkeiten ausgebildet wurden: zuerst die Mathematik unddie Physik, in denen bereits die Frage nach den Gründen gestellt wurde; dann die Dialektik, die eine höhere Form desArgumentierens etablierte; anschließend die Politik, die von Platon eingeführt wurde, der in der dialektischenMethode die größten Fähigkeiten besaß.
Er wurde nur noch von Aristoteles übertrumpft, dem es gelang, daswissenschaftliche Denken zum Abschluss zu bringen.
Denn er zeigte in seinem Organon und speziell in seinenZweiten Analytiken, dass man einen Sachverhalt nicht nur verteidigen, sondern unwiderlegbar beweisen kann.
DieseMethode ist jedoch nicht allen zugänglich.
Deswegen brauchten die Menschen nach Aristoteles noch einen anderen,einfacheren Zugang zur Wahrheit.
Er wurde ihnen durch die Religion, d.
h., konkret gesprochen, durch die Prophetengeschenkt.
Sie gründen ihre Aussagen nämlich nicht auf universale Begriffe und apodiktische Beweise, sondernführen ihre Anhänger zur rechten Einsicht, indem sie auf ältere und zugleich anschaulichere Formen desArgumentierens (vor allem Poesie und Rhetorik) zurückgreifen.
Damit war die Rollenverteilung noch pointierterformuliert.
Die Religion konnte nicht der Ort sein, um Wahrheiten zu ergründen oder gar zu beweisen.
Den Prophetenkommt vielmehr die Aufgabe zu, die Wahrheit unter all jenen Menschen zu verbreiten, die zu einer Beweisführungaußerstande sind.
Zu diesem Zweck benutzen sie Ausdrucksmittel, die jeder versteht.
Zu ihnen zählen Analogien,Symbole und Gleichnisse.
Denn, so heißt es an einer Stelle des Buches über Die Partikeln, «die Religion ...
dient zurUnterweisung der großen Menge über die theoretischen und praktischen Dinge, die in der Philosophie deduziertwurden, und zwar derart, dass den Menschen das Verständnis durch Überzeugung (= Rhetorik) oder das Evozierenvon Vorstellungen (= Poesie) oder durch beides zusammen erleichtert wird».
Bewiesen wird die Wahrheit (und zwardieselbe Wahrheit, keine doppelte, wie manchmal unterstellt wurde) allein durch die Philosophie.
Sie illustriert ihreAussagen nicht mit einzelnen Gleichnissen und Symbolen, sondern demonstriert sie am Allgemeinen des Begriffs.Deswegen ist sie auch keine partikulare Wissenschaft, die nur in einem bestimmten Sprach- und KulturkreisAnerkennung finden könnte (wie Grammatik, Theologie usw.), sondern eine universale Wissenschaft, die überallGültigkeit besitzt.
Allerdings wird die Philosophie nicht auf der ganzen Welt gepflegt, denn laut Fârâbî sind immer nurwenige Menschen in der Lage, sie zu verstehen und weiterzuentwickeln.
Das geschah zunächst in Griechenland, woPlaton und Aristoteles wirkten und die entscheidenden Weichenstellungen vornahmen.
Ihre Nachfolger setzten dieTradition fort, wobei sich der geographische Schwerpunkt im Laufe der Zeit nach Alexandria verlagerte.
Abermittlerweile wird auch dort nicht mehr philosophiert.
Die Philosophie hat nämlich inzwischen einen anderen Standort.Sie ist laut Fârâbî, der hier historische Informationen mit selbstlegitimatorischen Absichten verbindet, «vonAlexandrien nach Bagdad» gewandert und hat im Zentrum der islamischen Welt eine neue Heimat gefunden.
Unterdieser Prämisse konnte Fârâbî auch die anderen Teilgebiete der Philosophie selbstgewiss entwickeln.
Sie fügen sichSandini Archiv 34 Der dritte Entwurf: Abû Nasr al-Fârâbî in seiner Darstellung zu einem Gesamtbild, das denAnspruch, das erste philosophische «System» in arabischer Sprache zu sein, deutlich manifestiert.
Grundlegend istdabei die Idee der hierarchischen Ordnung.
Sie soll in analoger Weise auf drei Ebenen vorliegen: im Kosmos; imeinzelnen Menschen; und in der zwischen beiden vermittelnden staatlichen Gemeinschaft, deren Bedeutung Fârâbî sohoch einschätzte, dass er sein Hauptwerk Die Prinzipien der Ansichten der Bewohner des vorzüglichen Staatesgenannt hat.
Die kosmische Ordnung nimmt ihren Ausgang von Gott.
Er wird ganz aristotelisch als vollkommener, sichselbst denkender Geist beschrieben.
Allerdings meint Fârâbî im Unterschied zu Aristoteles, dass das göttliche Denkennicht nur reflexiv, sondern auch produktiv sei.
Aus ihm geht nämlich von Ewigkeit her ein Intellekt hervor.
SeinDenken richtet sich auf zwei Objekte und hat folglich zwei Effekte.
Er erkennt Gott und lässt dadurch einen weiterenIntellekt entstehen, und er erkennt sich selbst, was zur Entstehung der äußersten, gestirnlosen Himmelssphäreführt.
Dieser Vorgang wiederholt sich, bis eine Reihe von zehn Intellekten vorliegt.
Sie gibt Fârâbî die Möglichkeit,sämtliche Himmelssphären, die im ptolemäischen Weltbild vorausgesetzt wurden (neben der gestirnlosen Sphäre dieFixsterne, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond), einem kosmischen Intellekt zuzuordnen (unterAuslassung des ersten, «reinen» Intellekts).
Die Sphären sind es auch, die mittelbar die (als urewig und notwendiggedachte) Entstehung der Welt auslösten.
Ihre Kreisbewegungen und die dabei freigesetzten Kräfte führten nämlichzur Bildung einer sublunaren Materie.
Die unmittelbare Ursache unserer Welt ist jedoch der zehnte Intellekt.
Denn erspendete der gestaltlosen Materie die Formen und dirigiert auch weiterhin die Geschehnisse auf der Erde.Insbesondere ist er der Lenker unserer Erkenntnis, weshalb er von Fârâbî mit dem aktiven Intellekt des Aristotelesidentifiziert wird.
Der Hierarchie, die sich im Kosmos zeigt, entspricht die Hierarchie der Fähigkeiten des einzelnenMenschen.
Sie wird von Fârâbî ebenfalls beschrieben, wobei er allerdings keine neuen Beobachtungen oder Konzeptevorträgt, sondern sich im Wesent- lichen an die traditionellen Unterscheidungen zwischen den verschiedenenVermögen der Seele (Intellekt, Vorstellungskraft, Gedächtnis usw.) und den Organen des Körpers hält.
Die größteAufmerksamkeit findet dabei der Intellekt, der alle anderen Fähigkeiten leitet.
Er wird in einer eigenen Abhandlung(Über den Intellekt oder auch Über das Denken) untersucht, die schon deswegen interessant ist, weil sie erneutaufschlussreiche Beobachtungen über die verschiedenen Sprachebenen und Argumentationsformen der Menschenenthält (philosophischer, theologischer und allgemeiner Gebrauch des Wortes «Denken» usw.).
Im Kern folgt Fârâbîjedoch der Intellektlehre Kindîs.
Denn auch er meint, dass sich beim Denkvorgang vier Aspekte unterscheiden lassen.Sie lauten – in Abwandlung bzw.
in Vertiefung der vier Stufen, die Kindî differenziert hatte: der potentielle Intellekt,d.
i.
das allen Menschen eigene Vermögen zu denken; der aktuelle Intellekt, der schon mit den Prinzipien derWissenschaften vertraut ist und aus den körperlichen Dingen die Wesensformen abstrahiert hat; der erworbeneIntellekt, d.
i.
die höchste Erkenntnisstufe des Menschen, auf der auch die getrennten Wesenheiten (z.B.
diehimmlischen Intellekte) erfasst und die Ursachen des Seins durchschaut werden; und schließlich der aktive Intellekt,der, wie wir schon sahen, mit dem zehnten kosmischen Intellekt identifiziert wird.
Er schenkt unserer Seele dieErkenntnis, so wie die Sonne das Licht spendet.
Zugleich liegt in ihm die Verheißung des menschlichen Glücks, da eres zulässt, dass sich die Seelen, wenn sie die Stufe des erworbenen Intellekts erreicht haben (wofür es allerdings,wie wir gleich sehen werden, politische Voraussetzungen gibt), mit ihm vereinen.
Dieser letzte Punkt leitet über zuden Betrachtungen über die staatliche Gemeinschaft.
Denn nach Fârâbîs Vorstellung hängt die Entscheidungdarüber, ob wir das Glück erreichen können, eng mit dem Staat, in dem wir leben, zusammen.
Der Grund dafür istwieder eine strenge Analogie: Auch das Gemeinwesen kennt eine hierarchische Ordnung (deren einzelne Stände von.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Der zweite Entwurf: Abû Bakr ar-Râzî
- Der erste Entwurf: Abû Ya qûb al-Kindî
- ESPRIT DE L’UTOPIE (L’), Geist der Utopie, 1918. Ernst Bloch
- VAN DER MEERSCH Maxence : sa vie et son oeuvre
- Le personnage de NATHAN le Sage [Nathan der Weise]