Nietzsches Beurteilung von Goethe und Hegel
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
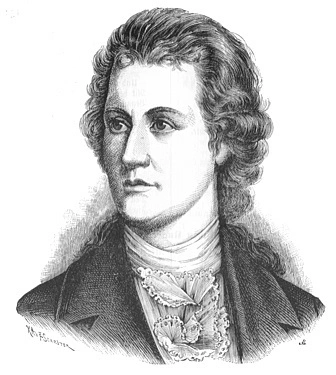
Nietzsche hat gemäß seinem Willen zu einer Entscheidung zwischen
Antike und Christentum in Hegel einen hinterhältigen Theologen und
in Goethe einen aufrichtigen Heiden gesehen. Zugleich hatte er aber
auch ein Bewußtsein von der Verwandtschaft ihres Geistes und ihrer
Gesinnung. »Die Denkweise Hegels ist von der Goetheschen nicht sehr
entfernt: man höre Goethe über Spinoza. Wille zur Vergöttlichung
des Alls und des Lebens, um in seinem Anschauen und Ergründen
Ruhe und Glück zu finden; Hegel sucht Vernunft überall, vor der
Vernunft darf man sich ergeben und bescheiden. Bei Goethe eine Art
von fast freudigem und vertrauendem Fatalismus, der nicht revoltiert,
der nicht ermattet, der aus sich eine Totalität zu bilden sucht, im
Glauben, daß erst in der Totalität alles sich erlöst, als gut und gerechtfertigt
erscheint.« 540 Zusammen mit Napoleon bedeuten ihm Hegel
195
und Goethe ein gesamteuropäisches Ereignis und einenVersuch,das18.
Jahrhundert zu überwinden.341
Das Bild, welches sich Nietzsche von Goethe machte, entbehrte zunächst
nicht der kritischen Vorbehalte, die aber immer mehr in den
Hintergrund traten. In der 3. Unzeitgemäßen Betrachtung stellt er
nach einer Charakteristik des 19. Jahrhunderts die Frage: wer wird in
einer solchen Zeit des Einsturzes und der Explosionen noch das »Bild
des Menschen« bewahren? Drei Bilder haben die Humanität der neueren
Zeit bestimmt: der Mensch Rousseaus, der Mensch Goethes und
der Mensch Schopenhauers, in dessen »heroischen Lebenslauf« sich
Nietzsche selber hineindeutet. Von Rousseau ist eine populäre Kraft
ausgegangen, die zu Revolutionen drängte; Goethe ist keine so bedrohliche
Macht, er ist beschauend und organisierend, aber nicht revolutionär
umstürzend. »Er haßt jedes Gewaltsame, jeden Sprung, das
heißt aber: jede Tat; und so wird aus dem Weltbefreier Faust gleichsam
nur ein Weltreisender. Alle Reiche des Lebens und der Natur, alle
Vergangenheiten, Künste, Mythologien, alle Wissenschaften sehen den
unersättlichen Beschauer an sich vorüberfliegen, das tiefste Begehren
wird aufgeregt und beschwichtigt, selbst Helena hält ihn nicht länger -
und nun muß der Augenblick kommen, auf den sein höhnischer Begleiter
lauert. An einer beliebigen Stelle der Erde endet der Flug, die
Schwingen fallen herab, Mephistopheles ist bei der Hand. Wenn der
Deutsche aufhört, Faust zu sein, ist keine Gefahr größer als die, daß
er ein Philister werde und dem Teufel verfalle — nur himmlische
Mächte können ihn hiervon erlösen. Der Mensch Goethes ist... der
beschauliche Mensch im hohen Stile, der nur dadurch auf der Erde
nicht verschmachtet, daß er alles Große und Denkwürdige... zu seiner
Ernährung zusammenbringt und so lebt, ob es auch nur ein Leben
von Begierde zu Begierde ist; er ist nicht der tätige Mensch: vielmehr,
wenn er an irgendeiner Stelle sich in die bestehenden Ordnungen der
Tätigen einfügt, so kann man sicher sein, daß nichts Rechtes dabei herauskommt
..., vor allem, daß keine >Ordnung< umgeworfen wird. Der
Goethesche Mensch ist eine erhaltende und verträgliche Kraft..., wie
der Mensch Rousseaus leicht zum Catilinarier werden kann.«542 In
ähnlicher Weise wird auch in der Betrachtung über Wagner gesagt,
Goethe sei zwar ein großer Lernender und Wissender gewesen, aber
sein vielverzweigtes Stromnetz scheine seine Kräfte nicht gesammelt
zum Meere zu tragen, sondern mindestens ebensoviel auf seinen Wegen
und Krümmungen zu verlieren. Es liege etwas Edel-Verschwenderisches
in Goethes Wesen, während Wagners (d. i. Nietzsches) Lauf
196
und Stromgewalt vielleicht erschrecken und abschrecken könne.543 Als
Nietzsche aber später selbst im Zarathustra eine Art von Vollendung
erreichte, ließ er seinen jugendlichen Vorbehalt schweigen, um die
Goethesche Existenz um so entschiedener anzuerkennen. Denn nicht
Goethes Schuld sei es gewesen, wenn sich die deutsche Bildung auf der
Schiller-Goetheschen Basis wie auf einem Ruhebett niederließ.544 Der
reife Nietzsche begriff, warum Goethe, der weder »ein Schriftsteller
noch ein Deutscher von Beruf« sein wollte, niemals wie Schiller populär
werden konnte, sondern trotz seines Ruhmes vereinsamt blieb und
genötigt war, sich gegenüber seinen Verehrern zu verschanzen und zu
maskieren.545 »Er gehört in eine höhere Gattung von Literaturen, als
>National-Literaturen< sind: deshalb steht er auch zu seiner Nation
weder im Verhältnis des Lebens, noch des Neuseins, noch des Veraltens.
Nur für Wenige hat er gelebt und lebt er noch: für die meisten
ist er nichts als eine Fanfare der Eitelkeit, welche man von Zeit zu Zeit
über die deutsche Grenze hinüberbläst. Goethe, nicht nur ein guter und
großer Mensch, sondern eine Kultur, Goethe ist in der Geschichte der
Deutschen ein Zwischenfall ohne Folgen: wer wäre im Stande, in der
deutschen Politik der letzten 70 Jahre zum Beispiel ein Stück Goethe
aufzuzeigen! (während jedenfalls darin ein Stück Schiller und vielleicht
sogar ein Stückchen Lessing tätig gewesen ist).« 546 Goethe —
heißt es an anderer Stelle — hat über die Deutschen hinweg gedichtet,
weil er in jeder Beziehung hoch über ihnen stand. »Wie könnte auch
je ein Volk der Goetheschen Geistigkeit im Wohlsein und Wohlwollen
gewachsen sein.« 547 Es folgte ihm nur eine sehr kleine Schar
»Höchstgebildeter, durch Altertum, Leben und Reisen Erzogener, über
deutsches Wesen Hinausgewachsener: er selber wollte es nicht anders«.
Weit entfernt vom »Idealismus« sah er diesem Treiben der deutschen
Bildung in seiner Art zu: »daneben stehend, mild widerstrebend,
schweigsam, sich auf seinem eigenen besseren Wege immer mehr bestärkend
«, während das Ausland glaubte, die Deutschen hätten »in
aller Stille eine Ecke des Himmels entdeckt«, als diese selbst bereits
anfingen, ihre idealistische Bildung mit industriellen, politischen und
militärischen Unternehmungen zu vertauschen.548
Was Goethe so hoch über alle kleineren Geister hinaushob, war, daß
er die Freiheit nicht nur wollte, sondern in ihrem vollen Besitz war.
Von dieser erreichten Freiheit aus konnte er sichs erlauben, selbst das
ihm Widerliche zu fördern und ein Fürsprecher des Lebens im Ganzen
zu sein, seiner scheinbaren Wahrheit und seines wahren Scheins. »Goethe
war, inmitten eines unreal gesinnten Zeitalters, ein überzeugter
197
Realist: er sagte Ja zu Allem, was ihm hierin verwandt war, er hatte
kein größeres Erlebnis, als jenes ens realissimum, genannt Napoleon.
Goethe konzipierte einen starken, hochgebildeten, in allen Leiblichkeiten
geschickten, sich selbst im Zaume habenden, vor sich selber ehrfürchtigen
Menschen, der sich den ganzen Umfang und Reichtum der
Natürlichkeit zu gönnen wagen darf, der stark genug zu dieser Freiheit
ist; den Menschen der Toleranz, nicht aus Schwäche, sondern aus
Stärke, weil er das, woran die durchschnittliche Natur zu Grunde gehen
würde, noch zu seinem Vorteil zu brauchen weiß; den Menschen, für
den es nichts Verbotenes mehr gibt, es sei denn die Schwäche, heiße sie
nun Laster oder Tugend. Ein solcher freigewordener Geist steht mit
einem freudigen und vertrauenden Fatalismus mitten im All, im Glauben,
daß nur das Einzelne verwerflich ist, daß im Ganzen sich alles
erlöst und bejaht — er verneint nicht mehr.«549 Das ist aber zugleich
die Formel für Nietzsches »dionysische Stellung zum Dasein« und in
der Tat scheint der letzte Aphorismus des Willens zur Macht aus dem--
selben Geist zu stammen wie Goethes Fragment über die Natur.
Dennoch ist Nietzsches Wille zur Macht von Goethes Natur so verschieden
wie das Extreme vom Maßvollen, die gärende Macht vom
geordneten Kosmos, das Wollen vom Können und die vernichtende
Schärfe des Angriffs von der wohlwollenden Ironie.550 Dieser Unterschied
äußert sich besonders deutlich in ihrer Stellung zum Christentum.
Nietzsche bemerkt zwar einmal, man müsse das »Kreuz« so wie
Goethe empfinden,551 aber er selbst empfand es ganz anders: er wollte
die Menschen statt des Leidens das Lachen lehren und sprach sein Gelächter
heilig. Zarathustra verhöhnt die Dornenkrone von Christus, indem
er sich selbst mit einer aus Rosen krönt.552 Diese Rosen haben weder
eine humane noch eine vernünftige Beziehung zum Kreuz; Zarathustras
»Rosenkranz-Krone« ist rein polemisch gegenüber der des
Gekreuzigten. Bis zu dieser Verkehrung hat sich das von Luther herkommende
Sinnbild der Rosenkreuzer gewandelt! Goethe war kein
Anti-Christ und eben darum der echtere Heide; sein »Gott« hatte es
nicht nötig, gegen einen andern zu sein, weil er überhaupt seiner positiven
Natur nach jedem Verneinen abgeneigt war. Daß aber seine
vollkommen reif gewordene Freiheit in der deutschen Kultur ohne
Folgen blieb, ist ebenso verhängnisvoll wie verständlich. »Die...
Deutschen glauben nur Geist zu haben, wenn sie paradox, d. h. ungerecht
sind.«553 Sie glauben zwar an Ideen, sie schauen aber nicht Phänomene554,
und darum ist ihre »Weltanschauung« eine ideologische
Konstruktion. Dieser Mangel an einer reinen Anschauung der Welt
198
hat im 19. Jahrhundert die Schüler von Hegel - über Goethe hinweg -
zur Herrschaft gebracht und sie zu den »eigentlichen Erziehern der
Deutschen dieses Jahrhunderts« 555 gemacht.
Eine solche Idee aus Hegels Philosophie war die der »Entwicklung«
oder des »Werdens«. »Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es nie
einen Hegel gegeben hätte, insofern wir (im Gegensatz zu allen Lateinern)
dem Werden, der Entwicklung instinktiv einen tieferen Sinn
und reicheren Wert zumessen als dem, was >ist<.«556 Der Deutsche ist
auch insofern von Hause aus Hegelianer, als er sich nicht am Unmittelbaren
der Phänomene genug sein läßt, sondern »den Augenschein
umdreht« und kaum an die Berechtigung des Begriffes »Sein« glaubt.
In dieser Hinsicht, bemerkt Nietzsche, waren auch Leibniz und Kant
»Hegelianer«. Die deutsche Philosophie glaubt eher als an die Regel
der Logik an das »credo quia absurdum«, mit dem die deutsche Logik
schon in der Geschichte des christlichen Dogmas auftritt. »Aber auch
heute noch, ein Jahrtausend später, wittern wir Deutsche von heute ...
etwas von Wahrheit, von Möglichkeit der Wahrheit, hinter dem berühmten
realdialektischen Grundsatze, mit welchem Hegel seinerzeit
dem deutschen Geiste zum Sieg über Europa verhalf -, >der Widerspruch
bewegt die Welt, alle Dinge sind sich selbst widersprechend< -
wir sind eben, sogar bis in die Logik hinein, Pessimisten.« 557 Und indem
Nietzsche sein eigenes Paradox von der ewigen Wiederkunft aus
der Selbstaufhebung des Nihilismus entwarf, hat er die Logik des
Widerspruchs bewußtermaßen noch einen Schritt weitergeführt und
abermals ein credo aus dem absurdum entwickelt.558
Doch unterscheidet sich Nietzsches pessimistische Logik durch seine
radikale Kritik der christlichen Moral und Theologie, deren Herrschaft
er auch in Hegels Philosophie der Geschichte erkannte.559 Mit
dieser hinterlistigen Theologie habe sich Hegel die große Initiative
verdorben, welche darin bestand, daß er bereits auf dem Weg war,
auch das Negative - den Irrtum und das Böse - in den Gesamtcharakter
des Seins einzubeziehen. »Gemäß dem grandiosen Versuch,
den er machte, uns zur Göttlichkeit des Daseins zu allerletzt noch mit
Hilfe unseres sechsten Sinnes, des >historischen Sinnes< zu überreden«,
wurde er zu dem großen Verzögerer in der Befreiung vom Christentum
und seiner Moral.560 Dieser philosophische Historismus habe die
gefährlichste Einwirkung auf die deutsche Bildung gehabt, denn
»furchtbar und zerstörend« müsse es sein, wenn ein solcher Glaube an
den Sinn der Geschichte zum Götzendienst des Tatsächlichen führe.
»Enthält jeder Erfolg in sich eine vernünftige Notwendigkeit, ist jedes
199
Ereignis der Sieg ... der >Idee< - dann nur hurtig nieder auf die Kniee
und die ganze Stufenleiter der >Erfolge< abgekniet.«561 Hegel hat für
die Folgezeit die Historie als Glauben an den Sinn der Geschichte zum
Ersatz der Religion gemacht.562 Gerade dieser Historismus, welcher
aus Hegels Metaphysik der Geschichte des Geistes entsprang, ist aber
zukunflvoller geworden als die unhistorische Weltanschauung von
Goethe, der die Entwicklungs- und Lebensformen der Menschheit aus
der Anschauung der Natur entnahm.
Liens utiles
- Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt
- GOETHE UND HEGEL
- WEISLINGEN Adelbert von. Personnage du drame de Goethe
- ENTRETIENS DE GOETHE AVEC LE CHANCELIER VON MULLER (résumé)
- Wasserspringen 1 EINLEITUNG Wasserspringen, Wassersport für Männer und Frauen, bei dem die Sportler von einem Sprungbrett oder einer Plattform in ein Becken springen und dabei bestimmte Figuren zeigen.






